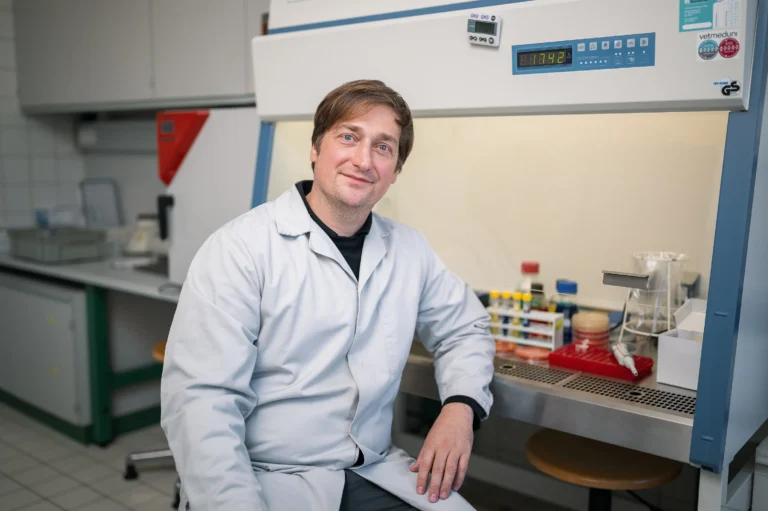Geht es nach den Materialwissenschaftern an der Montanuni Leoben, könnten tagelange Wartezeiten bei Tests auf das Corona-Virus schon bald der Vergangenheit angehören. Mit bereits seit Jahren eingesetzten kommerziellen Testgeräten und neuartigen Filterröhrchen, die in Leoben entwickelt wurden, müsste man nur wie in einen Alkomaten blasen und wüsste in ein paar Minuten, ob man infiziert ist oder nicht.
Wer derzeit auf das Corona-Virus getestet wird, muss einiges über sich ergehen lassen. Erst einmal muss er beim berühmt-berüchtigten Gesundheitstelefon 1450 vorstellig werden, gibt es dann grünes Licht für den Test, folgt das unangenehme Prozedere eines Nasen-Rachen-Abstriches. Und dann beginnt das Warten. Bis zu zehn Tage lang lebt man im Ungewissen und in vorsorglicher Quarantäne – ein unzumutbarer Zustand.
All das könnte schon bald der Vergangenheit angehören, wenn es nach den Forschern der Montanuni Leoben geht. Ein kleines Team unter Univ.-Prof. Dr. Christian Mitterer, Leiter des Lehrstuhls für Funktionale Werkstoffe und Werkstoffsysteme am Department Werkstoffwissenschaft, und Dr. Nikolaos Kostoglou vom gleichen Lehrstuhl arbeitet an einer Methode, bei der man wie bei einem Alkomaten nur in ein Filterröhrchen hineinblasen muss, um in ein bis zwei Minuten zu wissen, ob man mit Covid-19 infiziert ist oder nicht.
Möglich wird das durch Messung mit einem SERS-Gerät. SERS ist die Abkürzung für „Surface Enhanced Raman Scattering“, zu Deutsch „oberflächenverstärkte Raman-Streuung“, die nach ihrem Entdecker, dem indischen Physiker und Nobelpreisträger Chandrasekhara Raman benannt ist. SERS bezeichnet ein physikalisches Phänomen: Werden Moleküle mit elektromagnetischen Wellen bestrahlt, so werfen sie ein charakteristisches Signal zurück, anhand dessen das Molekül eindeutig identifiziert werden kann. Normalerweise ist dieses Signal extrem schwach. Bringt man jedoch das Molekül in die Nähe einer metallischen Oberfläche, wird das Signal so verstärkt, dass das Signal gemessen werden kann.
Die Methode ist lange bewährt
„Diese Methode ist seit vielen Jahren im Einsatz, mit ihrer Hilfe wird zum Beispiel auf Flughäfen nach Sprengstoff gesucht“, erläutert Christian Mitterer. „Wir haben das auf Covid-19 angewandt und entwickeln die SERS4SARS-Methode.“
In der Praxis beschichten die Leobener Forscher winzige Glasfasern mit Nanopartikeln aus Edelmetall, die in ein Proberöhrchen verpackt werden. Wenn jemand auf das Corona-Virus getestet werden soll, muss er nur wie bei einem Alkomaten in das Röhrchen blasen. Tröpfchen aus der Atemluft lagern sich an den Fasern an, die mit einem schwachen Laser beleuchtet werden. Befinden sich Covid-19-Viren in der Probe, werfen sie ein ganz bestimmtes Signal zurück, das vom Gerät erkannt wird.
Um welches Edelmetall es sich bei der Beschichtung handelt, verrät Mitterer natürlich nicht. Neben Kupfer, Silber, Gold und Platin kommen theoretisch auch „exotischere“ Elemente wie Osmium, Palladium, Rhodium oder Iridium in Frage, die ebenfalls zu den Edelmetallen zählen.
„Unser Ziel war es, eine Testmethode zu entwickeln, die nicht wahnsinnig viel neue Technologie verwendet“, schildert der Werkstoffspezialist. „Der große Vorteil unserer Entwicklung ist es, dass es die Testgeräte bereits auf dem Markt gibt und wir nur die Filtermethode neu entworfen haben.“ Diese Geräte kosten laut Mitterer „ein paar Tausend Euro“, sind aber dauerhaft verwendbar, weil ja nur das Filterröhrchen verbraucht wird.
Die SERS-Messtechnik selbst ist seit mehr als 45 Jahren bekannt, versichert der Leobener Universitätsprofessor. Bisher sei aber niemand auf die Idee gekommen, sie zur Detektion von Corona-Viren anzuwenden. „Theoretisch können mit SERS4SARS auch andere Viren identifiziert werden, man muss nur das charakteristische Raman-Signal finden. Und die Proben müssen nicht unbedingt aus der Atemluft gewonnen werden, auch Blutproben kann man so untersuchen.“ Im Prinzip könne die Identifizierung bei jeder Substanz gemacht werden, die eine eindeutige Molekülstruktur besitzt.
Zusammenarbeit mit Griechenland
Ursprünglich haben die Leobener das Projekt SERS4SARS gemeinsam mit dem griechischen Forschungsinstitut Demokritos bei der EU eingereicht, die zu Ostern einen Wettbewerb namens „EU versus Virus“ ausgeschrieben hatte. „Versprochen war eine Anschubfinanzierung für weitere Forschungen. Obwohl wir die Ausschreibung gewonnen haben, wurde dann aber leider nichts ausbezahlt“, erzählt Mitterer.
Momentan arbeiten die Werkstoffforscher mit zwei Virologen – einer in Graz, der andere in Alexandroupolis in Griechenland – zusammen, um erste Tests mit Corona-Viren zu machen. „Wir sind in der Proof-of-concept-Phase. Ist die positiv, stehen Gespräche mit der Industrie und Wissenschaftspartnern auf dem Programm, damit unsere Idee in die Praxis umgesetzt werden kann.“ Mitterer rechnet bis Ende dieses Jahres mit Ergebnissen.
Die Herausforderung werde die Herstellung der Filterröhrchen sein, glaubt der Werkstoffspezialist. „Einerseits technologisch, weil die metallischen Nanopartikel auf die Glasfasern aufgebracht werden müssen.“ Andererseits seien die Teströhrchen ein Wegwerfprodukt und müssten in entsprechend hoher Stückzahl produziert werden.
In Form und Konsistenz müsse man sich die Röhrchen wie einen Zigarettenfilter vorstellen, erzählt Mitterer. Der Filter habe im Inneren eine sehr große Oberfläche. „Der beste Filter, den wir entwickelt haben, hat pro Gramm eine Oberfläche von 2.000 bis 3.000 Quadratmeter.“ Allerdings diene er nicht dem Testen auf Corona, sondern der Speicherung von Wasserstoff.
Speichern und Trennen mit Spezialmaterial
Poröse Materialien für verschiedene Anwendungen einzusetzen, ist ein weiterer Forschungsschwerpunkt an Mitterers Lehrstuhl. Nicht nur für die Wasserstoffspeicherung, sondern auch zur Trennung von verschiedenen Gasen oder die Reinigung von Flüssigkeiten. „Mögliche Einsatzgebiete sind die Trennung von Methan und Kohlendioxid im Erdgas, die Entsalzung von Meerwasser oder die Filterung von Mikroplastik aus Abwässern“, schildert Mitterer.
Bei der Speicherung von Wasserstoff wird Kohlenstoff als poröser Werkstoff verwendet. „Der ist billig und der Speicherschwamm ist leicht herstellbar.“ Mobilität auf Basis von Wasserstoff sei ohne solche Speicher nicht umsetzbar, ist der Forscher überzeugt. „Unter Normalbedingungen, also einem bar Druck und Raumtemperatur, braucht ein Kilogramm Wasserstoff rund zwölf Kubikmeter Speicherplatz. Damit kann man vielleicht 100 Kilometer weit fahren.“
Darum werden derzeit in Fahrzeugen Überdrucktanks eingesetzt, in denen der Wasserstoff bei bis zu 800 bar gelagert wird. „So ein Tank kostet 3.000 Dollar, ein herkömmlicher Benzintank kommt auf 30 Dollar.“ Außerdem benötige jede Tankstelle einen Hochleistungskompressor, der den starken Überdruck erzeugen muss. „Weil der Druck nach jedem Tankvorgang wieder aufgebaut werden muss, kommt es zu relativ langen Wartezeiten.“
Mit einem Kohlenstoffspeicher kann der Tankdruck auf 10 bis 20 bar verringert werden. „Das sind dann Verhältnisse, wie sie in einer normalen Espressomaschine herrschen“, sagt Mitterer. Allerdings brauche es noch sehr tiefe Temperaturen, damit sich der Wasserstoff an der Kohlenstoffoberfläche anlagert. „Wir arbeiten mit minus 177 Grad Celsius, der Temperatur von flüssigem Stickstoff“, erläutert Mitterer. „Wir hoffen, dass wir den Prozess so optimieren können, dass er auch bei Raumtemperatur funktioniert.“ Schon in fünf Jahren, so der Wissenschafter, könnte es so weit sein, dass man mit einer Füllung des Kohlenstofftanks mehrere Hundert Kilometer weit fahren könne.
Insgesamt beschäftigt sich der Lehrstuhl hauptsächlich mit Beschichtungen. Dabei gibt es drei Schwerpunkte. „Wir arbeiten an Reibungsreduktion und Verschleißminderung, das ist für Werkzeuge, aber auch Motorenkomponenten interessant. Der zweite Bereich sind extrem dünne Schichten, zum Beispiel für Anwendungen in der Mikroelektronik oder flexiblen Displays. Dazu kommen Spezialbeschichtungen zur Aktivierung von Oberflächen.“ 35 wissenschaftliche Mitarbeiter sind an Mitterers Lehrstuhl tätig. Rund 40 Studierende wählen pro Jahr den Bereich Werkstoffwissenschaft.
Kontakt
christian.mitterer@unileoben.ac.at
Fotocredit: Shutterstock
Entgeltliche Medienkooperation: Die redaktionelle Verantwortung liegt beim JUST.