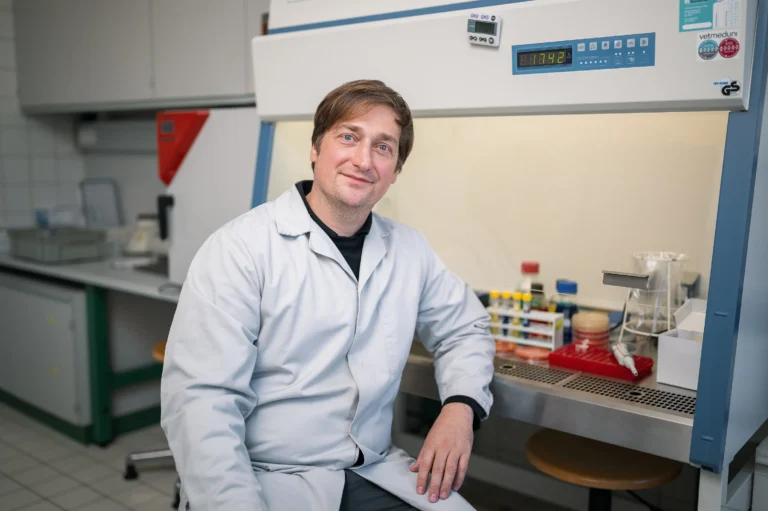Am Lehrstuhl für Funktionale Werkstoffe und Werkstoffsysteme des Departments Werkstoffwissenschaft der Montanuni Leoben werden selbstreinigende Schichten für die Spiegel von Sonnenwärmekraftwerken entwickelt. Genutzt werden dafür Methoden der Nanotechnologie.
Allen Unkenrufen und aller Kritik zum Trotz ist die Energiewende weltweit voll im Gange. Laut jüngsten Daten, die das Analytikunternehmen BloombergNEF zusammengetragen hat, war das Jahr 2019 das erste Jahr, in dem mehr Ökostromanlagen gebaut wurden als herkömmliche Kraftwerke. Demnach entfielen im Vorjahr mehr als zwei Drittel der neuinstallierten Leistung auf Wind- und Solarenergie. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 lag deren Anteil noch bei unter einem Viertel. Die CO2-Emissionen aus dem Energiesektor sind dadurch um 1,5 Prozent niedriger als im Jahr zuvor – die Steigerung in China wurden von Einsparungen in Europa und Nordamerika mehr als wettgemacht.
2019 war das Jahr einer weiteren Premiere: Der Ausbau der Solarenergie übertraf erstmals den Neubau von Windkraftwerken. Die direkte Nutzung der Sonnenenergie ist damit die weltweit viertwichtigste Quelle für elektrische Energie (hinter Kohle, Gas und Wasserkraft). Solarenergie rückt damit sukzessive dorthin, wo sie aus ökologischen Erwägungen hingehört: an die Spitze der Energiequellen, die dem Menschen zur Verfügung stehen. Immerhin strahlt die Sonne innerhalb weniger Stunden so viel Energie auf die Erdoberfläche, wie die Menschheit in einem ganzen Jahr benötigt. Man muss diese „nur“ ernten.
Schon seit Jahrzehnten ungebrochen ist der Boom der Solarthermie – also der Nutzung der Sonnenwärme zur Bereitung von Warmwasser in Sonnenkollektoren. Dank drastisch sinkender Kosten hatte in den letzten Jahren auch die Photovoltaik – also die Produktion von Elektrizität mithilfe von Silizium-Paneelen – stark steigende Tendenz.
Gebündelte Hitze der Sonne
Schon seit Langem bekannt – und vielfach erprobt – ist eine weitere Nutzungsart der Sonnenenergie: Sonnenwärmekraftwerke, im Englischen „Concentrated Solar Power Plants“ (CSP) genannt. In diesen Anlagen wird das Sonnenlicht mit exakt ausgerichteten Spiegeln an einem Punkt konzentriert, der dann sehr hohe Temperaturen (über 1000 Grad Celsius) erreicht. An diesem Punkt wird ein Wärmeträgermedium aufgeheizt – häufig ist ein flüssiges Nitratsalz, Wasserdampf oder Heißluft –, das schließlich eine Turbine und in der Folge einen Generator antreibt.
Vor allem in südeuropäischen Ländern spielen Sonnenwärmekraftwerke eine immer wichtigere Rolle bei der Abdeckung des Energiebedarfs – allein in Spanien gibt es bereits mehr als 50 solcher Anlagen. Große Investitionen laufen auch in einigen Ländern auf der arabischen Halbinsel. Laut einer Analyse der Internationalen Energieagentur IEA könnten Sonnenwärmekraftwerke im Jahr 2050 elf Prozent der weltweiten Elektrizität liefern. Allerdings: Trotz vieler neuer Technologien, die eingesetzt werden, sind die Stromgestehungskosten – also die Kosten, die durch die Energieumwandlung von einer anderen Energieform in elektrischen Strom entstehen – nach wie vor höher als bei konventionellen Kraftwerken.
Selbstreinigende Schichten für Spiegel
Eines der Problemfelder bei der Wirtschaftlichkeit von Sonnenwärmekraftwerken ist die Reinigung der Spiegel, die derzeit hohe Kosten verursacht und dadurch die Nutzung der Solarthermie erschwert. „Da der Spiegel die erste Komponente in Kontakt zum Sonnenlicht im Energieumwandlungsprozess darstellt, ist seine Effizienz kritisch für den gesamten Systemwirkungsgrad“, erläutert Christian Mitterer, Professor am Lehrstuhl für Funktionale Werkstoffe und Werkstoffsysteme des Departments Werkstoffwissenschaft der Montanuni Leoben. Ein Reflexionsverlust infolge einer Verschmutzung der Spiegel von einem Prozent führt direkt zu einer Steigerung der Stromgestehungskosten um ein Prozent. Dies stellt somit ein signifikantes Problem für den Betrieb sowie für die Betriebs- und Wartungskosten der Kraftwerksbetreiber dar.
Ein Forschungsteam um Mitterer will nun gemeinsam mit Partnern in Zypern und Griechenland Abhilfe schaffen. Gestartet wurde das Projekt „Nano4CSP“, in dem die Effizienz der Spiegel durch die Entwicklung spezieller Beschichtungen verbessert werden soll. Mithilfe innovativer chemischer und physikalischer Methoden sollen selbstreinigende und kratzfeste Schichten und Nanopartikel basierend auf Titanoxid sowie nanotexturierte polymere Beschichtungen für Spiegel von Sonnenwärmekraftwerken entwickelt werden.
Strukturierung der Oberfläche
Dabei werden zwei verschiedene Stoßrichtungen verfolgt: Zum einen geht es um „superhydrophile“ Schichten – hydrophil bedeutet „wasserliebend“, diese Oberflächen werden von Wasser sehr gut benetzt. An solchen Schichten können durch den sogenannten photokalalytischen Effekt organische Verschmutzungen und Staub entfernt werden. Dabei werden Verschmutzungen durch die Einwirkung des ultravioletten Anteils im Sonnenlicht zersetzt.
Zum anderen sollen aber auch „superhydrophobe“, also stark wasserabweisende Schichten eingesetzt werden. Auf solchen exakt strukturierten Oberflächen tritt der Lotoseffekt zur Oberflächenreinigung ein: Ein Wassertropfen, der auf der Oberfläche abperlt, nimmt dabei Schmutzteilchen mit. Dieses Prinzip hat sich die Wissenschaft von der Natur abgeschaut, wo es von vielen Pflanzen, etwa der Lotusblume, genutzt wird, die sich dadurch von Staub befreien. „Damit soll eine deutliche Steigerung des Wirkungsgrades von Sonnenwärmekraftwerken und eine Reduktion der Betriebskosten erreicht werden“, erklärt Mitterer.
Ökonomische Effizienz als Ziel
Das Gesamtziel des Forschungsvorhabens ist die Verringerung der Betriebs- und Wartungskosten sowie des Wasserverbrauchs und damit die Erhöhung des Wirkungsgrades von Sonnenwärmekraftwerken. Dies soll durch die Entwicklung und Optimierung der Eigenschaften von selbstreinigenden Oberflächen durch geeignete Oberflächenbehandlungs- und ‑beschichtungsverfahren erreicht werden. Die Entwicklung soll auf Schichten fokussiert sein, die im Zuge der Herstellung der Spiegel, aber auch auf bereits im Einsatz befindliche Installationen aufgebracht werden können.
Foto: Sonnenkraftwerk auf Zypern
Fotocredit: The Cyprus Institute Nicosia Zypern
Entgeltliche Medienkooperation: Die redaktionelle Verantwortung liegt beim JUST.