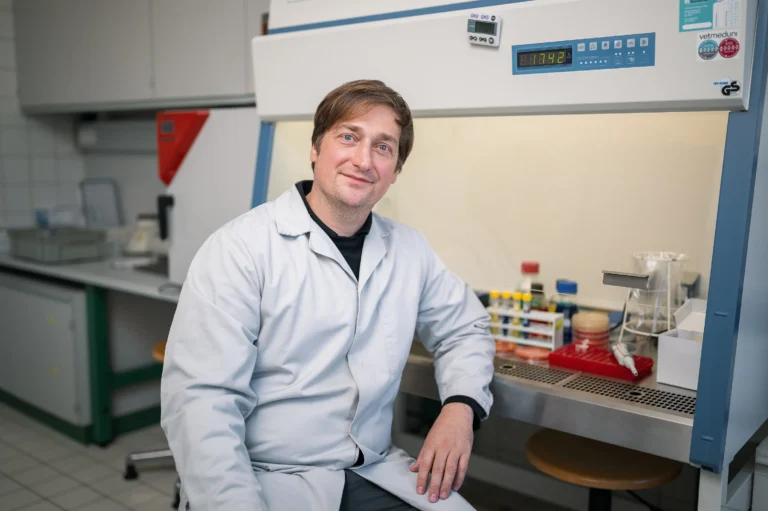Bei der Eisen- und Stahlerzeugung fallen eine Menge fester und flüssiger Reststoffe wie Stäube, Schlämme oder Schlacken an. Viele von ihnen enthalten noch Eisen, das in den Produktionsprozess zurückgeführt werden könnte. Am Kompetenzzentrum K1-MET GmbH mit den Standorten Linz und Leoben untersuchen Wissenschaftler in Kooperation mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft, wie man dies bewerkstelligen kann. Eine Anlage zur Behandlung von Stahlwerksstaub ist im Labormaßstab in Betrieb.
Bei der Verhüttung des Eisenerzes und der nachfolgenden Weiterverarbeitung des Roheisens zu Stahl fallen abzüglich der Hochofenschlacke, welche als Zuschlagstoff in der Zementindustrie eingesetzt wird und hinsichtlich Eisenrückgewinnung keine Rolle spielt, in Europa jährlich rund 35 Millionen Tonnen an metallurgischen Reststoffen an, die bis zu 85 Prozent Eisen enthalten. Das entspricht einem Eisenpotenzial von rund 15 Millionen Tonnen, das aus den Reststofffraktionen wiedergewonnen werden könnte.
Eine vollständige Rückführung der Reststoffe ohne Vorbehandlung ist allerdings nicht einfach. „Der Grund dafür liegt in diversen Begleitelementen abseits des Eisens, welche eine direkte Rückführung einiger Reststoffe nicht ermöglichen. Ein Beispiel ist Zink, welches zum Beispiel im Stahlwerksstaub enthalten ist und bis zu 15 Gewichtsprozent ausmacht“, schildert Johannes Rieger, Area Manager Raw Materials and Recycling & Metallurgical Processes bei der K1-MET GmbH. Wird ein zinkreicher Staub als sekundäre Eisenquelle im Hochofen genutzt, wirkt sich das nachteilig auf den Hochofenprozess aus: So entsteht ein erhöhter Bedarf an Reduktionsmitteln wie Koks, außerdem kommt es zu Anbackungen am Feuerfestmantel.
Im Fall von Stahlwerksstaub wird derzeit im Rahmen des von der FFG geförderten COMET-Kompetenzzentren-Programms K1-MET in Kooperation mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft ein Verfahren entwickelt, um diesen pyrometallurgisch zu behandeln. „Konkret setzen wir einen Hochtemperaturprozess mit Reaktortemperaturen bis zu 1700° Celsius ein, um das Wertmetall Eisen selektiv aus dem Staub abzutrennen und so zurückzugewinnen“, erklärt Rieger. Bereits am Laufen ist eine Laboranlage, die über eine Kapazität von 250 Kilogramm Reststoffen pro Stunde verfügt. „Bis Mitte nächsten Jahres wollen wir den nächsten Upscalingschritt abgeschlossen haben und das Konzept für eine semiindustrielle Anlage mit einem Durchsatz von einer Tonne pro Stunde entwerfen.“
Derzeit werden zinkreiche Reststoffe aus der Eisen- und Stahlerzeugung meist extern aufbereitet. Dabei ist es dort das Ziel, das Zink zu gewinnen und an die Zinkindustrie zu verkaufen. „Die Aufbereitung kostet die Stahlproduzenten viel Geld, außerdem geht das wertvolle Eisen verloren“, sagt Rieger. „Eisen ist global gesehen ja nur an wenigen Orten in konzentrierter Form vorhanden, Europa muss viel Erz importieren. Zumindest einen Teil dieser Importe könnte man sich durch unsere Methode sparen.“
Darüber hinaus, so der Wissenschaftler, sei eine Kreislaufwirtschaft eine wesentliche Säule bei den Bestrebungen, eine nachhaltige Stahlindustrie zu erreichen und so einen Beitrag zu den Klimazielen gemäß dem EU-Green-Deal zu leisten, dessen Hauptziel in einer CO2-Neutralität bis 2050 festgeschrieben ist.
Begonnen hat man am K1-MET schon 2015 an der Thematik zu arbeiten – Vorarbeiten bei den Projektpartnern starteten schon im Jahr 2010. Rund zehn Mitarbeiter – inklusive der Experten aus der Partnerindustrie – haben sich seither mit der Rückgewinnung von Eisen aus Reststoffen befasst. Das für nächstes Jahr geplante Konzept einer industriell einsetzbaren Anlage ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Rieger: „Danach werden wir uns wohl mit dem Recycling von Schrott auseinandersetzen und dies in den nächsten Jahren untersuchen. Denn auch im Schrott ist Zink vorhanden, das entfernt werden muss.“
Mehr Informationen:
www.k1-met.com
Foto: Johannes Rieger
Fotocredit: Montanuniversität Leoben (Lehrstuhl Thermoprozesstechnik)/K1-MET GmbH
“Science” wird mit finanzieller Unterstützung in völliger Unabhängigkeit unter der redaktionellen Leitung von Andreas Kolb gestaltet.