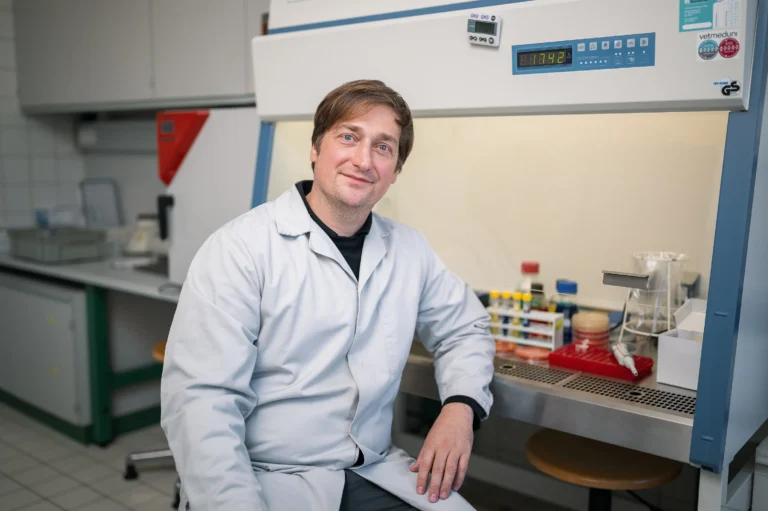Extrem haltbare Werkstoffe sind ein lang gehegter Wunsch der Menschheit. Was die Natur in einem Jahrmillionen andauernden Evolutionsprozess geschafft hat – nämlich Beschädigungen in einem biologischen Gewebe wirksam zu heilen – das versuchen Forscher am Polymer Competence Center Leoben (PCCL) auf Kunststoffe zu übertragen.
Die selbstheilenden Kunststoffe bieten eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten: Das sind zum einen alle Arten von Polymerbeschichtungen, zum anderen ganze Bauteile, etwa in der Fahrzeug- und Luftfahrtindustrie. Aber auch in der Medizintechnik könnten selbstheilende Polymere für eine Revolution sorgen. Denkbar ist ihr Einsatz nicht nur bei Prothesen, sondern auch beim sogenannten „tissue engineering“, also beim Nachbau menschlichen Gewebes. Dieses wird aus körpereigenen Zellen der Patienten gezüchtet, wofür man unter anderem ein Gerüst benötigt, welches aus Polymeren besteht.
„Wir arbeiten seit acht Jahren an diesen Polymeren“, schildert die Bereichsleiterin für die Chemie funktionaler Polymere am PCCL, Sandra Schlögl. Erforscht werden zwei Methoden, welche die Polymere zur Selbstreparatur anregen. „Das funktioniert einerseits mit UV-Licht, andererseits mit Temperatur. Beide können beschädigte Polymere dazu bringen, zähflüssig zu werden. Diese viskose Masse kriecht dann in entstandene Risse oder Kratzer und behebt diese. Das Ganze dauert nur 15 bis 60 Minuten. Die Temperatur muss nicht einmal besonders hoch sein: „Es funktioniert durchaus auch bei Raumtemperatur, das ist gerade bei Medizinprodukten wichtig.“
Spezielle Chemikalien müssen den selbstheilenden Polymeren nicht zugefügt werden, versichert Schlögl. „Wir verwenden jene Katalysatoren, die bei Polymeren ohnehin einesetzt werden, wenn man sie aushärten lässt.“
Ein ähnliches Verfahren, das die Wissenschafter am PCCL untersuchen, ist die Markierung von Beschädigungen. „Dabei sammeln sich in Rissen Farbstoffe, die unter UV-Licht hell strahlen. Bei medizinischen Handschuhen oder Kondomen sind ja Risse unter Umständen fatal“, erklärt Schlögl.
Und schließlich bieten die Selbstheilungsmechanismen der Polymere einen weiteren großen Vorteil. Ist das Material am Ende seiner Lebenszeit angelangt, muss es nur auf mehr als 100 Grad Celsius erhitzt werden und zerfällt dann in seine Ausgangsbestandteile. Diese können dann für die Erzeugung neuer Polymere verwendet statt thermisch verwertet werden.
Kontakt:
Polymer Competence Center Leoben GmbH
Roseggerstraße 12, 8700 Leoben
www.pccl.at
Foto: PolymerForscherin Sandra Schlögl
Fotocredit: PCCL
„Science“ wird mit finanzieller Unterstützung in völliger Unabhängigkeit von Andreas Kolb gestaltet.