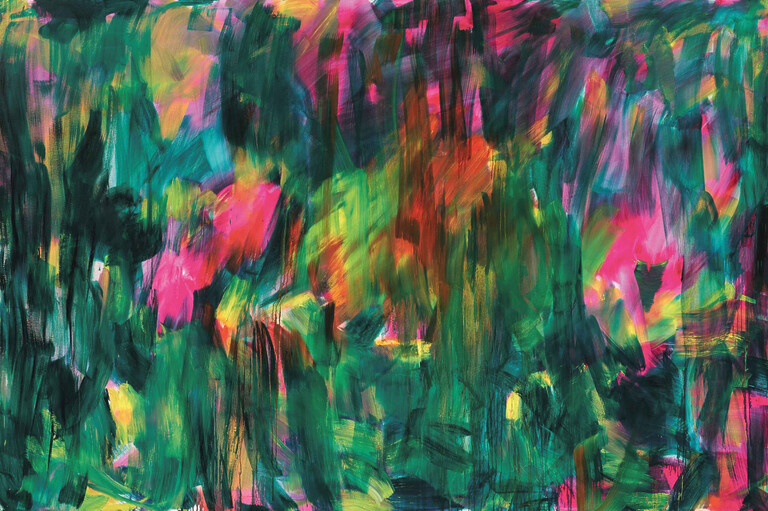Ein Thema das in aller Munde ist: Grüner Wasserstoff soll die Zukunft der Energieversorgung sein. Dieser Vision ist man nun dank der Montanuniversität Leoben einen Schritt näher. Mithilfe von Pyrolyse-Verfahren kann Methan (Erdgas) emissionsfrei in Wasserstoff und Kohlenstoff zerlegt werden. So erhält man einerseits den speicherbaren und klimaneutralen Energieträger Wasserstoff. Gleichzeitig wird der wichtige und derzeit knappe Rohstoff Carbon erzeugt. In einem großen Kooperationsprojekt mit Industriepartnern wollen Forscher diese Technologie nun in die Praxis bringen.
Grüner Wasserstoff für die Zukunft
Das Energiesystem der Zukunft soll nachhaltig und umweltfreundlich sein. Es sollen möglichst keine Treibhausgas-Emissionen anfallen, es soll Speichermöglichkeiten geben (um den fluktuierenden Anfall von Solar- und Windenergie ausgleichen zu können); die Energiebereitstellung soll umweltfreundlich vonstattengehen; und überdies soll die Versorgung gesichert sein.
Einsatzgebiete und Visionen
All diese Anforderungen kann Wasserstoff (H2) als Energieträger erfüllen: Dieses leichte Gas verfügt über eine hohe Energiedichte, verbrennt emissionsfrei zu reinem Wasser (H2O), lässt sich in bestehenden Gaspipelines transportieren und in Gasspeichern zwischenlagern – und sein Energiegehalt lässt sich sehr einfach in elektrischen Strom verwandeln (und umgekehrt). Überdies kann Wasserstoff als Rohstoff in der Industrie dienen, etwa für künftige emissionsfreie Methoden der Eisen- und Stahlerzeugung.
Schwierige Herstellung
Das Hauptproblem bei Wasserstoff ist, ihn auf umweltfreundlichem Wege in ausreichenden Mengen herzustellen. Eine gebräuchliche Methode ist die Elektrolyse von Wasser (also die Spaltung in Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe von elektrischer Energie). Um „grünen“ Wasserstoff zu produzieren, sind allerdings große Mengen an Strom aus erneuerbaren Quellen nötig. Derzeit wird Wasserstoff vorwiegend durch die Zersetzung von Methan (CH4; Erdgas, aber auch Biogas) hergestellt. Beim herkömmlichen Verfahren (Dampfreformierung) fallen aber große Mengen an CO2 an, von denen derzeit niemand weiß, was man damit sinnvollerweise machen könnte. Es wie bisher einfach in die Atmosphäre entweichen zu lassen, wird in Zukunft nicht mehr möglich sein – das würde den Klimawandel im wahrsten Sinn des Wortes weiter anheizen.
Wasserstoff und Carbon
Eine hervorragende Alternative könnte die sogenannte „Methan-Pyrolyse“ sein. Methan ist ein sehr wertvoller Rohstoff und Energieträger. Die Art und Weise, wie er heute eingesetzt wird, ist aber nicht nachhaltig: Verbrennt man Methan, entsteht bei der Oxidation Wasser und das Treibhausgas Kohlendioxid. Durch Pyrolyse könnte dieses Problem vermieden werden – und gleichzeitig ein sehr wertvoller Stoff erzeugt werden: Denn unter Luftabschluss zerfällt Methan bei bestimmten Bedingungen in seine Bestandteile: Es entsteht zum einen Wasserstoff-Gas und zum anderen bleibt der Kohlenstoff (C ) in fester Form zurück. Diesen Rückstand nennt man in der Fachsprache „Carbon“, man kennt ihn etwa in Form von Graphit.
Essentiell für Technologie
Carbon gilt als extrem wertvoller industrieller Rohstoff für die nachhaltige Produktion von Baustrukturen, Batterien, Computerchips, Kohlenstofffasern und für die Herstellung carbonbasierter Materialien, die etwa in der Luft- und Raumfahrt oder der Sport- und Freizeitbranche eingesetzt werden. Eine in den letzten Jahren immer stärker an Bedeutung gewinnende Modifikationen von Carbon ist Graphen: Dieser zweidimensionale Zukunftswerkstoff ist ultradünn, leicht, stabil und elektrisch leitend, seine Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Darüber hinaus findet Carbon Verwendung in Brennstoffzellen, kann als Wasserstoffspeicher eingesetzt werden oder findet sich in der Wasser‑, Boden- und Luftaufbereitung als Schlüsselstoff wieder.
Saubere Sache
Der Clou an der Methan-Pyrolyse wäre daher, dass die Herstellung des sauberen, flexiblen und klimaneutralen Energieträgers Wasserstoff mit der Produktion von wertvollem Carbon einhergeht, was einen signifikanten Beitrag zu den Gestehungskosten von Wasserstoff liefern könnte. „Diese Zukunftstechnologie vereint die Ziele Dekarbonisierung, Transformation von und zu Energieträgern sowie die Erzeugung von kritischen Rohstoffen“, erläutert Peter Moser, Vizerektor der Montanuniversität Leoben. „Das aus der Pyrolyse gewonnene hochwertige Carbon hat das Potenzial, vielfältige nachhaltige Technologien erst zu ermöglichen und zu revolutionieren.“
Von der Theorie zur Praxis
Die Sache hat allerdings einen Haken: Die Methan-Pyrolyse funktioniert derzeit nur im Labormaßstab. Nun will aber ein Konsortium aus der Montanuniversität Leoben und den Industriepartnern voestalpine Stahl, Primetals Technologies Austria, Wien Energie und RAG Austria einen großen Schritt zur großtechnischen Umsetzung in der Praxis machen. Im Rahmen eines großen Kooperationsprojekts werden mögliche Pyrolyse-Prozesse von Methan untersucht. Dadurch will man wichtige Daten über die Prozessführung, den Umsatz von Methan, den spezifischen Energiebedarf und die Qualität der Produkte erhalten. Von besonderem Interesse sind die Zusammensetzung und die Struktur bzw. die Modifikation des anfallenden Kohlenstoffes. Im Forschungsfokus liegen weiters die Langzeitstabilität und die Skalierbarkeit des Prozesses sowie technisch, wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Verwertungswege. Überdies wird eine sorgfältige Lebenszyklusanalyse für die Methan-Pyrolyse erstellt.
Energiewende in Sicht!
Auf der wissenschaftlichen Seite wird das Projekt vom Resources Innovation Center Leoben, das Peter Moser leitet, vorangetrieben. Für die Forscher ist die kombinierte Erzeugung von Carbon und Wasserstoff durch die Methan-Pyrolyse ein gutes Beispiel für das sogenannte „Sustainable Energy Mining“-Konzept. Von diesem innovativen Prinzip verspricht man sich einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende in Österreich, einen Innovationsschub für die österreichische Industrie, eine Stärkung der regionalen Wertschöpfung sowie eine Steigerung der Versorgungssicherheit.
Essentiell für Österreich
„Österreich braucht in jedem Fall saubere und leistbare Energie für Strom, Wärme und Mobilität und kann daher massiv von diesen Zukunftstechnologien profitieren“, bestätigt Markus Mitteregger, CEO der RAG Austria AG. Dieses Unternehmen, das die größten Gasspeicher Österreichs betreibt, fungiert in dem Projekt als Industrie-Projektkoordinator. „Wir liefern einerseits die Möglichkeit zur Energiespeicherung als zentrales Element der Energiezukunft, die eine Energieernte im Sommer und Lagerhaltung für den Winter ermöglicht, und andererseits das Zukunftsmaterial Carbon sowie leistbaren Wasserstoff aus Pyrolyse und umweltfreundliche Kraftstoffe wie LNG für einen sauberen Schwerverkehr“, so Mitteregger.
Gemeinsame Arbeit
Die weiteren Projektpartner bringen jeweils spezifische Stärken und Erfahrungen sowie relevante Daten ein, sie sind in der Folge bei der Planung und Errichtung einer Pilotanlage federführend. Die Steel Division der voestalpine arbeitet bereits an Möglichkeiten zur Verwirklichung einer CO2-armen Stahlproduktion auf Basis von Wasserstoff. Primetals Technologies Austria GmbH bietet Metallerzeugern moderne, individuell angepasste Anlagenausrüstung und Services und will die Zukunft der Metallbranche mitgestalten. Und für die Wien Energie ist grüner Wasserstoff ein wichtiger Baustein für mehr Klimaschutz: Geprüft werden derzeit Anwendun in den Bereichen Industrie, Mobilität und Energiespeicherung. Alle Kooperationspartner setzen auf Carbon und Wasserstoff „Made in Austria“.
Ort der Forschung
Im Resources Innovation Center Leoben sind die internationalen Beteiligungen der Montanuniversität Leoben im Bereich der nachhaltigen Rohstoffforschung und Ausbildung gebündelt. Das umfasst etwa die beiden im Rahmen der Initiative „European Institute of Innovation and Technology“ eingerichteten Netzwerke EIT RawMaterials und EIT Climate-KIC, Projekte im Rahmen des europäischen Forschungsrahmenprogramms Horizon 2020 bzw. Horizon Europe oder die „European Innovation Partnership on Raw Materials“. Überdies werden zahlreiche Projekte abgewickelt, die sich
Entgeltliche Medienkooperation. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim JUST.