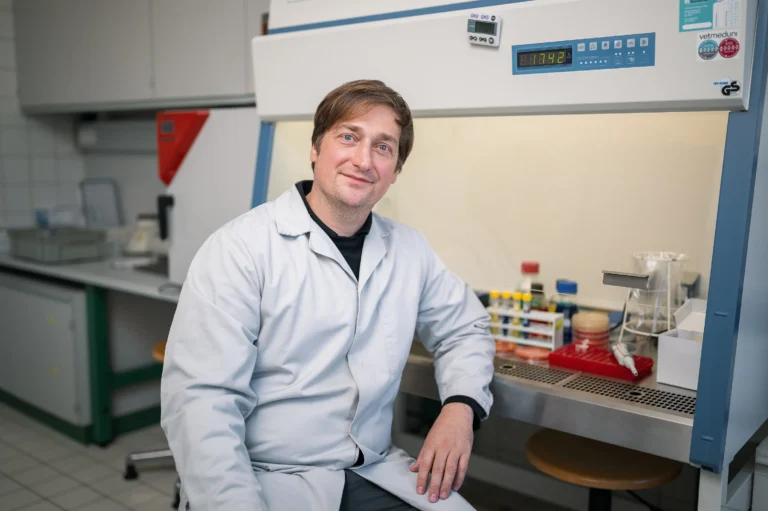Superkondensatoren sind, ähnlich wie Batterien, moderne Energiespeicher für die wiederholte Speicherung von elektrischer Energie. Sie weisen im Vergleich zu Batterien zwar geringere Energiedichten auf, können aber viel schneller und öfter geladen und entladen werden (mehr als eine Million Zyklen). Aber was macht Superkondensatoren eigentlich so schnell? Und wie könnte, ohne an Ladegeschwindigkeit zu verlieren, mehr Energie gespeichert werden? Diese Fragestellungen versuchen Wissenschaftler der Arbeitsgruppe von Univ.-Prof. Dr. Oskar Paris am Institut für Physik der Montanuniversität Leoben unter Beteiligung von Wissenschaftlern der Technischen Universität Graz und dem Institut für neue Materialien in Saarbrücken in ihrer neuesten Publikation im Fachblatt Nature Communications zu beantworten.
Superkondensatoren im Alltag
Superkondensatoren werden z. B. von in Graz verkehrenden Stadtbussen innerhalb weniger Sekunden an jeder Haltestelle, während des Ein- und Austeigens der Fahrgäste, aufgeladen. Auch werden sie immer häufiger als effiziente Pufferspeicher, z. B. für die schnelle Zwischenspeicherung von Bremsenergie in Fahrzeugen oder ganz allgemein in Energiemanagementsystemen in der E‑Mobilität oder bei der Speicherung erneuerbarer Energiequellen eingesetzt. Sämtliche verwendeten Materialien und Rohstoffe sind überdies grundsätzlich umweltfreundlich, nicht entflammbar, kostengünstig und ausreichend verfügbar.
„Die hohe Geschwindigkeit ist eine Folge des einfachen physikalischen Prinzips der Ladungsspeicherung an einer elektrischen Doppelschicht“, erläutert Paris. „Entgegengesetzte Ladungen von Elektronen und Ionen ziehen sich an der Grenzfläche zwischen einer Kohlenstoffelektrode und einem Elektrolyten elektrostatisch an, und dabei werden die Ionen in winzigste Nanoporen der hochporösen Elektrode transportiert. Die Größe und Anordnung dieser Poren im Verhältnis zur Größe der Ionen beeinflusst nicht nur die Menge an gespeicherter Energie, sondern ganz entscheidend auch die Geschwindigkeit des Ladevorganges“.
Um die dabei ablaufenden Vorgänge und Mechanismen besser zu verstehen, entwickelten die Leobener Forscher eine neue experimentelle Methode. „Wir messen einfach die Absorption von Röntgenstrahlung in der Elektrode während des Ladens und Entladens, und sind damit in der Lage, direkt auf die Anzahl von positiv und negativ geladenen Ionen in der Elektrode rückzurechnen – und dies mit einer zeitlichen Auflösung von wenigen Sekunden“, beschreibt der Erstautor Dipl.-Ing. Dr.mont. Christian Prehal die im Rahmen seiner Leobener Doktorarbeit entwickelte Methodik.
Entgegen bisheriger Expertenmeinungen lassen die Röntgenmessungen erkennen, dass selbst lange nach Beendigung des eigentlichen Ladungsausgleichs zwischen Elektrode und Elektrolyt noch eine Zunahme der Ionen in den nanoporösen Elektroden erfolgt. „Unsere Ergebnisse zeigen die Nicht-Gleichgewichtsnatur des Ladevorgangs in Superkondensatoren, selbst bei sehr langsamen Ladezyklen. Diese Erkenntnis rückt die Ladungsspeicherung in Superkondensatoren in ein völlig neues Licht und wir können nun versuchen durch die gezielte Wahl geeigneter Ionen oder maßgeschneiderter nanoporöser Elektroden die Performance weiter zu verbessern“, erläutert Prehal abschließend.
Foto: Vier der fünf Autoren v.l: Dr. Christian Prehal, Dipl.-Ing. Christian Kocwara, Univ.-Prof. Dr. Oskar Paris, Assoz.Prof. Dr. Heinz Amenitsch
Fotocredit: Montanuni Leoben