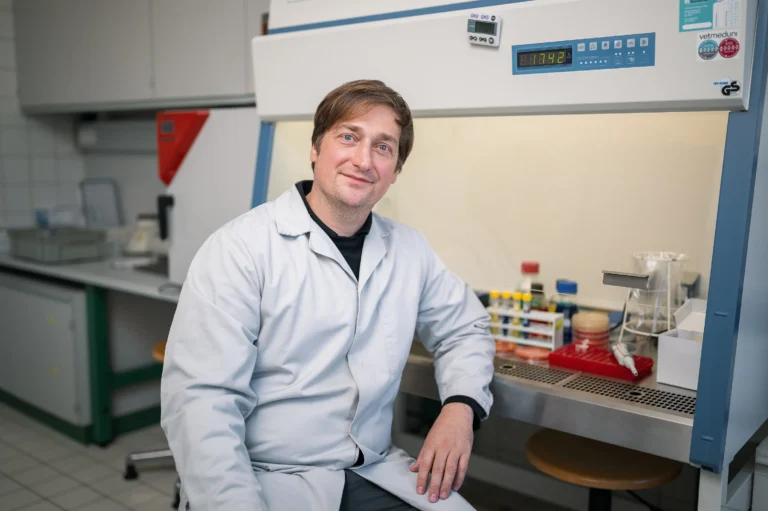Für eine umfassendere Exploration und vor allem stärkere Nutzung europäischer Rohstoffe tritt der Leiter des Lehrstuhls für Geologie und Lagerstättenlehre an der Montanuniversität Leoben, Frank Melcher, ein. Nur so könne Europa die Abhängigkeit von Rohstoffimporten zumindest abmildern.
Frank Melcher geht es nicht nur um die gefragten Seltenen Erden, das rare Kobalt und das begehrte Lithium. Zumindest nicht nur. Völlig unterschätzt werde, so der Wissenschafter, der Bedarf der EU an Massenrohstoffen für die Transformation zu einer emissionsärmeren Wirtschaft, wozu auch Grundstoffe wie Beton oder Stahl zählen. „Wir sollten Zement, Beton und Stahl in Zukunft nicht in großen Mengen importieren müssen, wenn wir diese selbst herstellen können“, kritisiert Melcher.
Er hat ausgerechnet, welche Rohstoffe der geplante Ausbau der Windenergie auf eine Erzeugungskapazität von zehn Terawattstunden allein in Österreich brauchen würde. Die Zahlen sind gigantisch: 6 Millionen Tonnen Beton, 2 Millionen Tonnen Stahl, 160.000 Tonnen Glas und 400.000 Tonnen Eisen wären nötig. Demgegenüber würden „nur“ 2000 Tonnen Seltene Erden gebraucht. Letztere müssten tatsächlich aus China eingeführt werden, da es sie in Europa in abbaufähiger Form schlicht und ergreifend nicht gibt. Ein Teil der Rohstoffe könnte aber sehr wohl aus dem eigenen Land kommen.
Während Eisen nach wie vor im großen Maßstab am steirischen Erzberg abgebaut und in Österreich zu Stahl weiterverarbeitet wird, sieht es bei vielen anderen Rohstoffen anders aus. „Wir haben eine heimische Zementindustrie, aber deren Ausstoß wird ja bereits für andere Bauvorhaben wie Straßen oder Wohnraum benötigt“, schildert Melcher. Eine Erhöhung der Kapazität könne es nur über umfangreiche Genehmigungsverfahren geben und hier greife die Mentalität „not in my backyard“. „Es ist wie mit Handymasten oder den Windrädern“, seufzt Melcher, „die Bürger wollen davon profitieren, aber keinesfalls selbst betroffen sein.“
Endlos lange Genehmigungsverfahren kann sich in der Rohstoffgewinnung niemand leisten, weiß der Geologe. „Das ist einfach nicht finanzierbar.“ Dabei würden jene Menschen, die sich gegen den Rohstoffabbau wehren, unterschätzen, „dass der Green-Deal-Anstrengungen von allen erfordern wird“.
20 bis 30 Jahre kann es laut Melcher dauern, bis ein Bergbau so richtig ins Laufen komme. „Am Anfang steht eine Machbarkeitsstudie, bei der durch Probebohrungen Menge und Qualität exploriert werden müssen. Abbau- und Aufbereitungskosten müssen genau prognostiziert werden. Dieser Prozess kostet sehr viel Geld und dauert gut zehn Jahre.“ Anschließend müsse sich das Projekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterziehen und schließlich müsse man sich mit den Grundeigentümern einigen. Das alles brauche häufig noch einmal zehn Jahre. Dazu komme das Explorationsrisiko: „Im Durchschnitt wird aus einem von 1000 erkundeten Rohstoffvorkommen tatsächlich ein Abbau.“
Graphit ist für Melcher ein gutes Beispiel dafür, dass es in Österreich ungenutzte Potenziale gibt. In der Böhmischen Masse, einem Gebiet, das sich von Tschechien bis nach Oberösterreich hinein erstreckt, sind reiche Lagerstätten von Graphit bekannt. „Früher hat man diesen Rohstoff für die Stahlerzeugung in Linz verwendet. In den 1980er-Jahren wurde das dann gestoppt, weil zu viel Schwefel emittiert wurde. Der Graphitbergbau ist dann verschwunden, bis auf ein kleines Unternehmen, das ein Vorkommen bei Leoben ausbeutet.“
Graphit brauche man heute für ganz andere Dinge als für die Stahlerzeugung. So bestehen 30 bis 40 Gewichtsprozent eines Akkus aus dem Kohlenstoff. Der Großteil des Graphits, der dabei zum Einsatz kommt, ist natürlichen Ursprungs, allerdings wird zunehmend auch synthetischer Graphit eingesetzt. Wegen des E‑Mobilitäts-Booms, so Melcher, steige der Bedarf enorm: „Bis 2050 wird die Welt vier Mal so viel Graphit brauchen, wie in den vergangenen 35 Jahren global abgebaut wurde. Es ist absolut unrealistisch zu glauben, dass diese Menge von den bestehenden Abbauen geliefert werden kann.“ Österreich könnte mit einer Reaktivierung seiner Graphitförderungen helfen, den absehbaren Mangel zu mildern.
Ähnlich sieht es mit Lithium aus, das ebenfalls für Akkus gebraucht wird. Melcher: „Auf der Koralm gibt es ein großes, abbauwürdiges Vorkommen. Es ist seit 1981 bekannt, gefördert wird noch nichts. Jetzt bemüht sich zwar ein Unternehmen um die Genehmigungen und Finanzierung, wie lange das dauern wird, ist aber nicht abzusehen.“ Bis 2050 wird weltweit übrigens 13 Mal so viel Lithium benötigt, wie in den letzten 35 Jahren gewonnen wurde.
Sich ausschließlich auf Importe zu verlassen hält Melcher für gefährlich. „Viele Rohstoffe kommen aus China. Aber dort sind manche Lagerstätten immer schwieriger abzubauen, andere wurden geschlossen, weil auch China den Umweltschutz entdeckt hat und die schlimmsten Auswüchse sukzessive abstellt.“ Andere Lieferanten seien afrikanische Länder, in denen die politische Situation instabil sei und der Abbau oft unter menschenunwürdigen Bedingungen vonstattengehe.
Der Leobener Wissenschafter plädiert dafür, dass die Explorationsaktivitäten hochgefahren werden – gerade in Europa. „Insgesamt passiert weltweit zu wenig, außer bei Gold. Das Traurige dabei ist nur, Gold benötigen wir für den Green Deal gar nicht.“
Recycling ist nur teilweise eine Lösung, schildert Melcher. „Bei Kupfer, Blei oder Zink funktioniert das ganz gut. Hier werden in der EU schon 33 bis 111 Prozent des Eigenverbrauchs wiedergewonnen. Schlechter sieht es hingegen bei Aluminium, Nickel oder Zinn aus, wo nur 35 bis 21 Prozent des Bedarfs aus Recycling gedeckt wird.“
Außerdem sei die Wiedergewinnung von Rohstoffen aus alten Geräten nicht so einfach, wie man sich das vorstelle. Melcher nennt als Beispiel ausrangierte Handys: „Ein Smartphone besteht aus rund 60 verschiedenen Stoffen. Wiedergewonnen werden können nur wenige Metalle. Die haben bei einem Handy einen Wert von knapp einem Euro. Davon sind 80 Cent Gold.“ Letzteres werde tatsächlich recycelt – der Rest landet mangels Wirtschaftlichkeit auf der Deponie.
Kontakt:
www.unileoben.ac.at
„Science“ wird mit finanzieller Unterstützung in völliger Unabhängigkeit unter der redaktionellen Leitung von Andreas Kolb gestaltet.