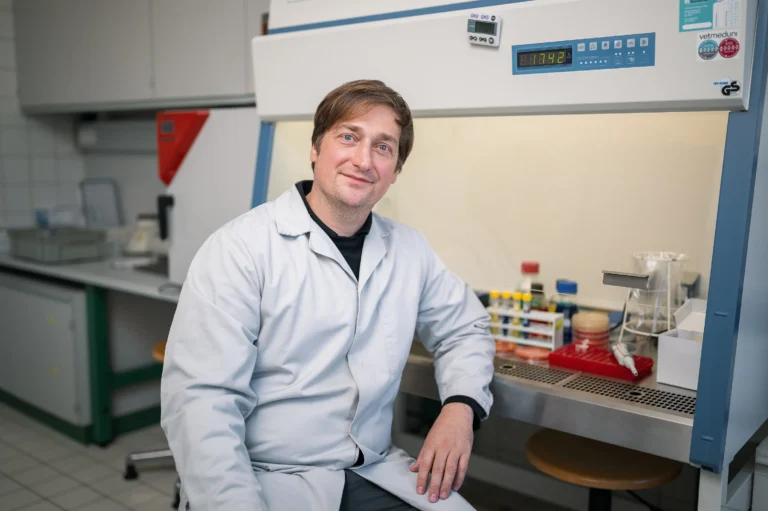Die Digitalisierung und der Bergbau sind nicht voneinander zu entkoppeln. In einem Handy sind zum Beispiel mehr als 40 Metalle enthalten, die im Bergbau gefördert werden.
Umgekehrt hat die Digitalisierung längst Einzug in eine der ältesten Aktivitäten der Zivilisation gehalten. An der Montanuniversität Leoben arbeitet man an nachhaltigen Lösungen für den Bergbau.
„Es geht uns um Nachhaltigkeit im Bergbau“, unterstreicht Michael Tost, der Professor für nachhaltige Bergbautechnologien am Lehrstuhl für Bergbaukunde, Bergtechnik und Bergwirtschaft an der Montanuni Leoben ist. Er hat dabei nicht nur, aber auch die sogenannten Konfliktminerale im Auge. Darunter versteht man Elemente wie Gold, Tantal, Wolfram oder Zinn, deren Abbau besonders große Einflüsse auf die Umwelt und auf die Gesellschaft hat, da sie zur Finanzierung bewaffneter Konflikte genutzt werden. In einem Handy kommen sie alle vor.
Allerdings in Mengen, so Tost, die im Grammbereich liegen. „Deshalb haben wir auch den Bezug dazu verloren. Denn auch wenn in einem einzelnen Handy nur wenig Metall verbaut ist, das zusammen vielleicht einen Wert von 2 Euro hat, so gibt es doch Milliarden Smartphones auf der Welt. Global gesehen kommen da enorme Mengen an Metall zusammen. So betrachtet können wir uns das Wegwerfen dieser Geräte nicht leisten.“
Bedauerlicherweise sei das Recycling von Metallen aus Handys technisch zwar durchaus möglich, wirtschaftlich aber nicht sinnvoll. „Wir müssen die Prozesse in der Herstellung ändern, um das rentabel zu machen. Das fängt damit an, dass es beispielsweise besser wäre zu schrauben statt zu kleben.“ Und es wäre nötig, nicht so viele verschiedene Materialien in ein Gerät einzubauen, die Hälfte würde nach Ansicht von Tost reichen. „Wir müssen schon im Design das spätere Recycling berücksichtigen.“
Eine große Herausforderung wird die Elektromobilität sein, ist Tost überzeugt. „Der Bedarf an Lithium in der EU wird sich laut Prognosen versechzigfachen! Das hat zur Folge, dass neue Vorkommen erschlossen werden müssen, aber auch dass der Bergbau zukünftig anders aussehen wird müssen als heute.“
Einerseits werde man sich um einen möglichst CO2-neutralen Abbau bemühen müssen, vor allem aber könne für den Abbau nicht mehr so viel Land verbraucht werden wie bisher. „Wenn überhaupt, dann muss der Tagbau so klein wie möglich gehalten werden“, fordert Tost.
Denkbar sei der Abbau unter Tage mittels Lösungen. „Man kann Bakterien in die Lagerstätten einbringen, die zum Beispiel Kupfer aus dem Gestein lösen. Die angereicherte Lösung pumpt man dann nach oben.“ Das habe den Vorteil, dass an der Oberfläche nur wenig Land verbraucht werde, zudem blieben kaum Hohlräume im Gestein zurück, die später verfüllt werden müssen. Zudem müsse man den Wasserverbrauch im Bergbau einschränken.
Zunehmend komme die Digitalisierung ins Spiel: Die Bergbauplanung erfolge schon heute nur mehr digital. „Da wird ein Abbild der Lagerstätte erstellt, ein dreidimensionales Modell, mit dem dann gearbeitet wird. Das betrifft sowohl den Tagbau wie auch den Bergbau in der Tiefe. Für jeden Abbau wird ein digitaler Zwilling erstellt, an dem verschiedene Varianten und ihre Folgen simuliert werden können.“ So könne nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch verschiedene Einflüsse durchgespielt werden. Ein Beispiel seien Wetterereignisse und ihre möglichen Folgen für einen Tagbau. „Man kann zum Beispiel den Abbau an tiefere Stellen verlegen, wenn weiter oben Schnee prognostiziert ist“, beschreibt Tost.
Eine weitere Anwendung der Digitalisierung werden die Bergbaumaschinen selbst sein. „Selbstfahrende Muldenkipper können rund um die Uhr in Betrieb sein. Sie bewegen sich gleichmäßiger als von Menschen gesteuerte Fahrzeuge, was einen geringeren Kraftstoffverbrauch bedeutet – egal, ob die Kipper mit Diesel oder mit Strom angetrieben werden.“
Ein Thema sind für Tost auch selbstfahrende Maschinen, die unter Tag automatisch den Lagerstätten folgen werden. „Sie brauchen weniger Platz, kaum Klimatisierung – ihnen ist es gleichgültig, dass mit der Tiefe die Temperatur steigt. Und sie benötigen, wenn sie elektrisch betrieben werden, auch keinen Sauerstoff.“ Das sei keine reine Utopie mehr, sein Lehrstuhl beteilige sich konkret an einem EU-Projekt, in dessen Rahmen festgestellt werden soll, welche Sensoren und welche Konzepte für solche Abbauroboter nötig sind und wie der Transport des abgebauten Materials an die Oberfläche vonstattengehen könne. Gerade in der komplexen Geologie der Alpen würden solche Roboter viele Vorteile mit sich bringen.
Ein weiterer Bereich, erklärt Tost, ist die die digitale Datenerfassung im laufenden Abbau. „Wir versuchen hier an der Montanuni, Gebirgsanker zu digitalisieren.“ Gebirgsanker sind Metallkonstruktionen, mit denen Stollen- oder Tunnelwände stabilisiert werden. „Wir haben hier in Leoben leitfähige Kunststofffolien entwickelt, mit denen man auch eine Dehnung messen kann. Bringt man diese Folien an den Gebirgsankern an, können wir in Echtzeit die Kräfte messen, die das Gebirge auf den Anker ausübt, wenn es sich bewegt.“
Generell, schildert Tost, sucht man an der Montanuni nach kostengünstigen Lösungen für die Digitalisierung des Bergbaus. „Jedes Handy enthält heute Beschleunigungssensoren, die fast nichts kosten. Wir schauen uns an, ob diese Sensoren in Bergbaumaschinen einsetzbar sind, etwa in den großen Radladern. Wenn wir da Bewegungsmuster erstellen, kann deren Arbeit meistens effizienter gemacht werden.“
Beteiligt ist die Montanuniversität Leoben auch an dem EU-Projekt DigiEcoQuarry. Dabei werden Steinbrüche und Schottergruben digital erfasst. Das gilt für alle Bereiche von der Abbauvorbereitung über die Extraktion und den internen Transport zum Lager bis hin zum Transport des Produktes zu den Kunden. Derzeit werden nur rund ein Prozent der Daten aus diesem Sektor des Rohstoffabbaus digital erfasst.
Kontakt:
www.unileoben.ac.at
Foto: Michael Tost, Professor für nachhaltige Bergbautechnologien am Lehrstuhl für Bergbaukunde, Bergtechnik und Bergwirtschaft an der Montanuni Leoben
Fotocredit: MUL
„Science“ wird mit finanzieller Unterstützung in völliger Unabhängigkeit unter der redaktionellen Leitung von Andreas Kolb gestaltet.