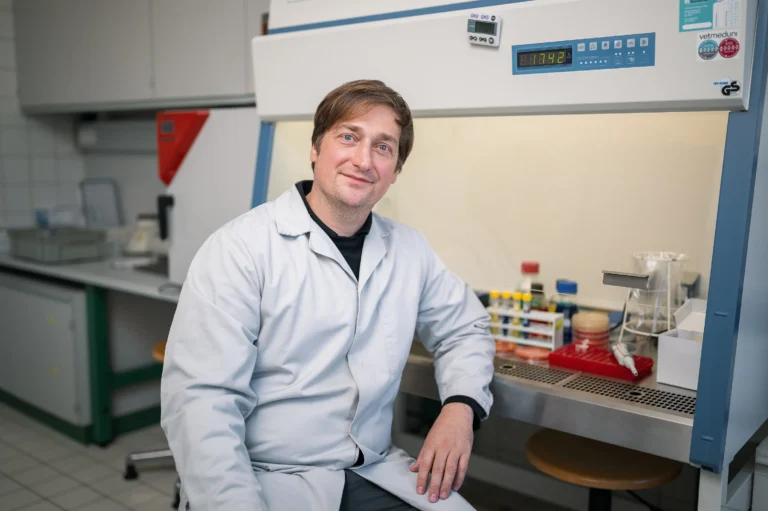Die Brennstoffzelle ist einer der Hoffnungsträger bei der Energieversorgung umweltfreundlicher Elektroautos. Bisher konzentrierte sich die entsprechende Entwicklung auf Pkw. Beim Grazer Entwicklungs‑, Prüf- und Simulationsspezialisten AVL sieht man aber eine breitere Anwendungspalette: Auch Lkw, Schiffe, Lokomotiven und Flugzeuge könnten mit Brennstoffzellen betrieben werden. Großes Potenzial liegt auch in dezentralen Kleinkraftwerken, die ganze Siedlungen mit Strom versorgen.
Wir stehen bei der Brennstoffzellen-Technologie vor einer Trendwende“, ist der Leiter des weltweiten Fuel-Cell-Competence-Teams bei AVL, Jürgen Rechberger, sicher. Bis vor Kurzem habe man vor allem an den Einsatz der Technologie, bei der Wasserstoff und der Sauerstoff in der Luft an zwei von einer Membran getrennten Elektroden zu Wasser reagieren und dabei Strom erzeugen, im Pkw gedacht. „Da hat die durchschnittliche Lebensdauer einer Zelle, die bei 5.000 bis 6.000 Stunden liegt, ausgereicht.“ Jetzt fasse man aber auch andere Anwendungen ins Auge, bei denen die notwendige Lebensdauer fünf- bis sechsmal so hoch liege.
Die Lebensdauer einer Brennstoffzelle wird unter anderem vom Katalysator begrenzt, mit dem die Elektroden beschichtet sind. Meist verwendet man dafür Platin. Das Edelmetall Platin ist relativ teuer, so kostet ein Gramm Platin auf dem Weltmarkt derzeit rund 40 €. Allerdings ist Platin gut recycelbar – mehr als 90 Prozent des Edelmetalls können aus gebrauchten Brennstoffzellen zurückgewonnen werden.
Kernforschungsthema bei AVL sind im Moment langlebige Brennstoffzellen, die im Lkw zum Einsatz kommen können. „Es geht dabei vor allem darum, den Konflikt zwischen hoher Leistungsdichte und hoher Lebensdauer zu lösen. Dazu glauben wir, mit unserer Gen 0 Stacktechnologie einen entscheidenden Durchbruch erzielt zu haben“, ist Rechberger stolz.
Der Leiter des Fuel-Cell-Teams sieht in der Brennstoffzellentechnologie eine kosteneffiziente Möglichkeit, E‑Autos langstreckentauglich zu machen. „Das ist für den Transportsektor unabdingbar. Ich bin sicher, dass sich das Prinzip bei Langstrecken-Lkw durchsetzen wird. Und mit den Brennstoffzellen-Elektro-Lkw wird das Wasserstoff-Tankstellennetz kommen, das dann auch für Pkw zur Verfügung stehen wird.“
Zwar werde der Akku bei den Pkw den Markt dominieren, so Rechberger, aber man werde wohl alle Alternativen ebenso nutzen. Die Brennstoffzelle werde bei hoher Nutzungsfrequenz, dem Fehlen von Ladeinfrastruktur oder häufigen Langstreckenfahrten zum Einsatz kommen. „Elektrofahrzeuge werden für viele Konsumenten eine ideale Lösung sein. Um der Elektromobilität zum kompletten Durchbruch zu verhelfen, wird es aber eine zweite Technologieoption brauchen.“, sagt Rechberger. „Schnellladen ist inzwischen rein technisch gut möglich, nur die nötige Infrastruktur fehlt. Und das werde wohl auch langfristig so bleiben, denn: „Wenn man in Österreich alle Privatfahrzeuge elektrisch betreibt und nur jeweils ein Prozent davon gleichzeitig an einen Schnelllader hängt, bräuchte man dreimal so viel Strom, wie derzeit hierzulande im Schnitt erzeugt wird.“
Enormes Potenzial sieht der AVL-Teamleiter in der Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC). Diese sei beim Kraftstoff flexibel, Wasserstoff könne ebenso verstromt werden wie Erdgas oder jegliches Gemisch der beiden. Auch ein Betrieb mit Methanol oder Äthanol – also Alkohol – sei möglich. „Dieser Typ ist ideal für die dezentrale Energieversorgung. Wir entwickeln bei AVL gerade Geräte mit einer Leistung von 250 Kilowatt, die natürlich auch in Gruppen bis in den Megawattbereich skaliert werden können. Weil die SOFC mit sehr hohen Temperaturen zwischen 500 und 800 Grad Celsius arbeitet, kann die Wärme ausgekoppelt und zum Heizen verwendet werden.“
Bei der Mobilität eignen sich Brennstoffzellen nicht nur für die Straße, sondern auch für die Schiene und vor allem für Schiffe. Lokomotiven mit Brennstoffzellen würden wahrscheinlich mittelfristig eher im Personenverkehr Anwendung finden, glaubt Rechberger. Dort seien die Nutzlasten nicht so groß und Lokomotivleistungen von bis zu 400 Kilowatt ausreichend. Im Marinesektor würden wohl Kreuzfahrtschiffe die ersten Anwender sein. Aber auch der Frachtverkehr zu Wasser sei ein Thema. So entwickelt der Verbund mit zahlreichen europäischen Partnern ein Projekt, bei dem in Rumänien erzeugter Wasserstoff über die Donau verschifft werde. „Wir als AVL arbeiten an dem Schiffsantrieb, der auf Brennstoffzellen basiert. Wenn grüner Wasserstoff quer durch Europa transportiert wird, kann das ja nicht mit konventionellen Dieselantrieben gemacht werden.“ Die nötige Leistung von Schiffsmotoren, die zwischen einem und 60 Megawatt liegt, sei für Brennstoffzellen kein Problem, schildert Rechberger: „Man schaltet einfach genug Module zusammen.“
Knackpunkt beim Thema Brennstoffzelle ist für Rechberger die Erzeugung des nötigen Wasserstoffs. Der wird derzeit hauptsächlich aus Erdgas gewonnen. „Wir müssen da aber komplett auf ‚grünen‘ Wasserstoff setzen, sonst macht das Ganze keinen Sinn und wäre auch nicht glaubwürdig.“ Interessanterweise ist hier die Umkehrreaktion der Brennstoffzelle auch die entscheidende Lösung.
„Wenn man das System umdreht, also Wasser oder Wasserdampf in eine Brennstoffzelle (heißt dann Elektrolyse) leitet und Strom an die Elektroden anlegt, kommen Wasserstoff und Sauerstoff heraus. Den Strom für den Betrieb gewinnt man aus erneuerbaren Energiequellen, am besten aus der zeitweiligen Überschusserzeugung von Solarzellen und Windrädern.“ Besonders vorteilhaft verläuft diese Reaktion in einer von AVL entwickelten Hochtemperaturelektrolyse, bei der noch zusätzlich Abwärme für die Verdampfung des Wassers herangezogen werden kann. Mit dieser Technologie kann Wasserstoff mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent erzeugt werden.
Der Wasserstoff aus Elektrolyse kann auch bei einem anderen großen Entwicklungsgebiet von AVL verwendet werden: der Erzeugung von synthetischem Treibstoff in Power-to-Liquid-Anlagen. In diesen wird der Wasserstoff mit Kohlenmonoxid zu Benzin verschmolzen. Weil es sich nicht um einen fossilen Brennstoff handelt, ist der synthetische Treibstoff bei der Verbrennung CO2-neutral.
AVL, so Rechberger, habe in Graz eines der weltweit größten Wasserstoff-Testcenter in Betrieb genommen. Bis zu zwei Megawatt Kapazität seien auf den Prüfständen testbar. „Wir können in beide Richtungen untersuchen – sowohl die Energieerzeugung als auch die Wasserstoffgewinnung.“
Insgesamt, so der AVL-Fuel-Cell-Teamchef, ist der Bereich Brennstoffzelle in der Forschung und Entwicklung stark wachsend. Sein Team umfasst derzeit rund 100 Mitarbeiter an drei Standorten: Graz, wo mit 50 Mitarbeitern der Löwenanteil der Forschung stattfindet, dem ungarischen Kecskemet und dem kanadischen Vancouver. „Wir sind dabei nur ein Teil der gesamten Wasserstoff-Mannschaft von AVL, die rund 350 Mitarbeiter umfasst.“
Auch in der Corona-Krise wächst das Brennstoffzellenteam bei AVL. Auch heuer erwarten wir einen weiteren Bedarf an Fachexperten im Brennstoffzellenbereich.“
Kontakt
Jürgen Rechberger
Manager Global Fuel Cell Competence Team
AVL List GmbH
Foto: Jürgen Rechberger, Leiter des Fuel-Cell-Teams von AVL
Fotocredit: Jorj Konstantinov
Science wird mit finanzieller Unterstützung von AVL, Joanneum Research, MUL, MCL, LEC, ZWI in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet.