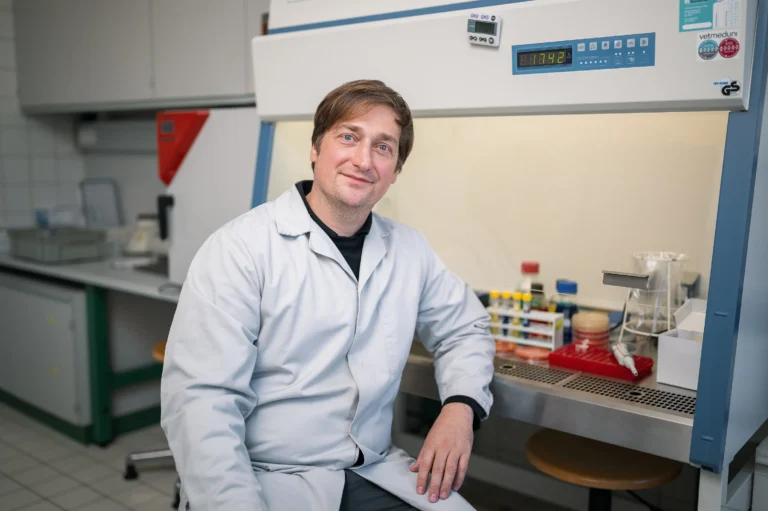Die Lust am Erforschen, Entdecken und Erfinden ist so alt wie die Menschheit selbst und in unserer DNA verankert. Die Aussicht auf Ruhm und Ehre trieb Menschen schon immer zu Grenzüberschreitungen, der Kult der Kreativität ist präsenter denn je. Freilich: Das eine oder andere Mal geht auch etwas schief.
Wagemutige sorgen stets dafür, dass den Geschichtsschreibern der Stoff nicht ausgeht. Schließlich gilt: Über den Tellerrand zu blicken, kann den Lauf der Welt verändern. Die größte Entdeckung der Welt ist zugleich der berühmteste Irrtum aller Zeiten. Auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien entdeckte Christoph Kolumbus 1492 Amerika. Jahrhunderte später vermaß Alexander von Humboldt, der gewissermaßen als Rockstar der Wissenschaft gelten kann, Teile des Kontinents. Allein in den Regenwäldern Südamerikas sammelte der Forschungsreisende riesige Mengen an Proben, fertigte 60.000 Zeichnungen an und absolvierte Tausende Expeditionskilometer. 30 Jahre lang war er mit der Aufarbeitung seiner Daten – biologische, geografische, botanische, astronomische, geologische – beschäftigt und schrieb das Meisterwerk „Kosmos“, das von 1845 bis 1862 in fünf Bänden erschien.
Die höchst intensive, ja teils fast besessene Auseinandersetzung mit der Materie ist dem Forschungsprozess oftmals wesensimmanent. Wenn es um seine Turbinen ging, habe der steirische Ingenieur Viktor Kaplan, der Anfang des 20. Jahrhunderts lange Zeit an der Deutschen Technischen Hochschule Brünn tätig war, alles andere vergessen, heißt es. Man erzählt sich, dass der Erfinder der Kaplan-Turbine vor einem Festvortrag im Frack noch schnell zu einer Versuchsturbine ins Labor geeilt sei und begonnen habe, diese zu regulieren – daraufhin habe man ihn triefend nass in den Festsaal geholt.
Radikal verändert
Freilich, nicht alle Entdeckungen entstehen rein aus individuellem Antrieb, sie sind teilweise auch in rigide Befehlshierarchien und den Wunsch nach politischer Vormachtstellung eingebettet; viele Entdeckungsreisen waren eher dem Eroberungs- und Selbstbedienungsgedanken geschuldet als dem vorurteilslosen Wissenserwerb. Die Bandbreite dessen, was der Mensch in den Jahrhunderten an Neuem erkundet und hervorgebracht hat, ist jedoch enorm und reicht von genialen Alltagserfindungen bis hin zu Ergebnissen hochkomplexer Forschung. Und sein Entdeckungswille lässt ihn stets nach mehr streben – er will unter größten Anstrengungen auf den höchsten Gipfel, selbst wenn die Aussicht auch anderswo schön ist.
Manchmal bleibt der Ruhm zu Lebzeiten auch verwehrt: Der Lehrer Johann Philipp Reis erfand 1859 das Telefon. „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“ lautete der erste Satz, der über 100 Meter telefonisch übermittelt wurde. Allerdings war vorerst nur Reis von seiner großen Erfindung überzeugt. Jahre nach seinem Tod meldete der Amerikaner Graham Bell einen weiterentwickelten Apparat 1875 zum Patent an. Nun denn: Der Siegeszug des Telefons hat das menschliche Kommunikationsverhalten radikal verändert. Der Schweizer Johann Ludwig Burckhardt, der im Auftrag der britischen African Association als einer der ersten Europäer syrische und jordanische Gebiete bereiste, gilt als Wiederentdecker der antiken Felsenstadt Petra. Seine Entdeckung machte er 1812 allerdings undercover als Scheich Ibrahim ibn Abdallah, um auf seinen Reisen unerkannt zu bleiben. Erst nach seinem Tod wurde sein Name in Zusammenhang mit der Entdeckung dieser sagenumwobenen Stätte bekannt.
Manche Erfindungen provozieren auch nicht ganz so erwünschte Reaktionen: Der Erfinder des faltbaren Beipackzettels soll keines natürlichen Todes gestorben sein, der Erfinder des Sofas habe danach nie wieder etwas Neues erdacht, der Erfinder der Autokorrektur soll in der Hallo schmoren, wird gerne gescherzt.
Evolutionäres Programm
Dennoch gilt: Forschergeist und Entdeckungswille sind gewissermaßen in unserer DNA festgeschrieben. Von Beginn seines Lebens an will der Mensch mit allen Sinnen die Welt erkunden, entdecken, erfahren. „Dieses Bedürfnis nach Exploration, unser Neugierverhalten, ist tief in uns verankert“, sagt die Klinische Psychologin Elisabeth Glauninger, „evolutionär betrachtet stellt es das Fortbestehen unserer Art sicher, da nur durch die fortwährende Auseinandersetzung mit der Umwelt eine optimale Anpassung an sich verändernde Umgebungsbedingungen und damit Überleben ermöglicht wird.“ Aus der Entwicklungspsychologie weiß man, dass die ungestörte Verarbeitung von unterschiedlichen Reizeindrücken auch die Voraussetzung für die Entwicklung höherer Funktionen wie Sprache, kognitive Leistung, aber auch von Verhaltensmustern und emotionaler Stabilität bildet. So kann auch die Lust am Entdecken bereits in jungen Jahren gut gefördert werden, „indem man durch Anreize in der Umgebung optimale Bedingungen und die Grundlage für die spätere Lern- und Leistungsmotivation schafft“, betont Glauninger.
Der Mensch ist keine Insel. Er ist ein soziales Wesen. Und daher gilt: „Motivation ist immer auch auf andere ausgerichtet“, sagt Soziologin Katharina Scherke. Darin liegt gewissermaßen ein Paradox begründet: Man will sich von anderen unterscheiden, zugleich aber auch Bestätigung dafür. Das Streben nach Einzigartigkeit auf der einen Seite macht Anerkennung aus dem sozialen Kreis auf der anderen Seite möglich. Das wiederum trägt zum eigenen Status bei. So richtig Fahrt aufgenommen hat dieses Phänomen erst mit der Aufklärung, so Scherke, als der Mensch zum Maß der Dinge wurde. Mit Pierre Bourdieu gesprochen: Soziale Distinktion als der Wille zur Abgrenzung rückt das Selbstbild, den eigenen Lebensstil, die persönlichen Vorstellungen in den Vordergrund. „Die zunehmende Individualisierung und die Suche nach Authentizität sind eine starke Triebkraft auf der Suche nach Neuem“, konstatiert die Wissenschafterin.
Auch Soziologe Georg Simmel, der sich als einer der ersten wissenschaftlich mit Modeerscheinungen auseinandergesetzt hat, thematisiert den Dualismus zwischen Nachahmung und Abgrenzung, Individuum und Kollektiv. „Die Dynamik auf der Suche nach noch nicht Dagewesenem wird nicht zuletzt dadurch gefördert, dass das Neue irgendwann nicht mehr neu ist und das Streben danach wieder beginnt.“ Die Moderne hat eine immensen Motor dafür geschaffen: Immer schneller muss dieser Prozess vor sich gehen. Um zu explorieren, brauche es natürlich Freiraum und ökonomische Möglichkeiten. Bestehen diese nicht, sei der Rahmen weit hemmender.
„Gerade heute existiert ein regelrechter Kult der Kreativität, ein Drang, sich ständig neu zu erfinden. Man ist zum Unternehmer seiner selbst geworden. Das kann natürlich auch Zwänge erzeugen“, sagt Scherke. Gleichzeitig wandelt man stets auf der Schwelle zum Außenseitertum: Der Grat, was noch Anerkennung und Wertschätzung erfährt und was nicht, kann schmal sein.
Jede Menge Zweifler
Ob Robert E. Peary tatsächlich am 6. April 1909 als erster Mensch den Nordpol erreicht hat, ist nach wie vor umstritten. Die jubelnden Worte über den Triumph sind als einzige nicht im Expeditionstagebuch vermerkt, sondern auf separaten Blättern verfasst. Das schürt die Annahme eines nachträglichen Verfassens. Die fotografischen Dokumente lassen keine eindeutige geografische Bestimmung zu, obwohl Peary die Kenntnisse dafür gehabt hätte. Die Bewältigung derart umfassender letzter Tagesetappen nährt ebenfalls Zweifel. Dass ein Vorhaben allerdings auch wider alle Zweifler gelingen kann, hat Mary Kingsley bewiesen: Ungeachtet aller Bedenken und warnender Wortmeldungen war die Ethnologin 1893 von England aus im Alleingang zu einer Expedition in den unerforschten Westen Afrikas aufgebrochen. „Jede Chance auf einen sicheren Tod muss man auf das Niveau einer sportlichen Herausforderung reduzieren“, wird sie zitiert. Als Pionierin der modernen Anthropologie ist sie in die Annalen eingegangen. Mut kann man eben nicht kaufen.
Illustration: Gernot Reiter