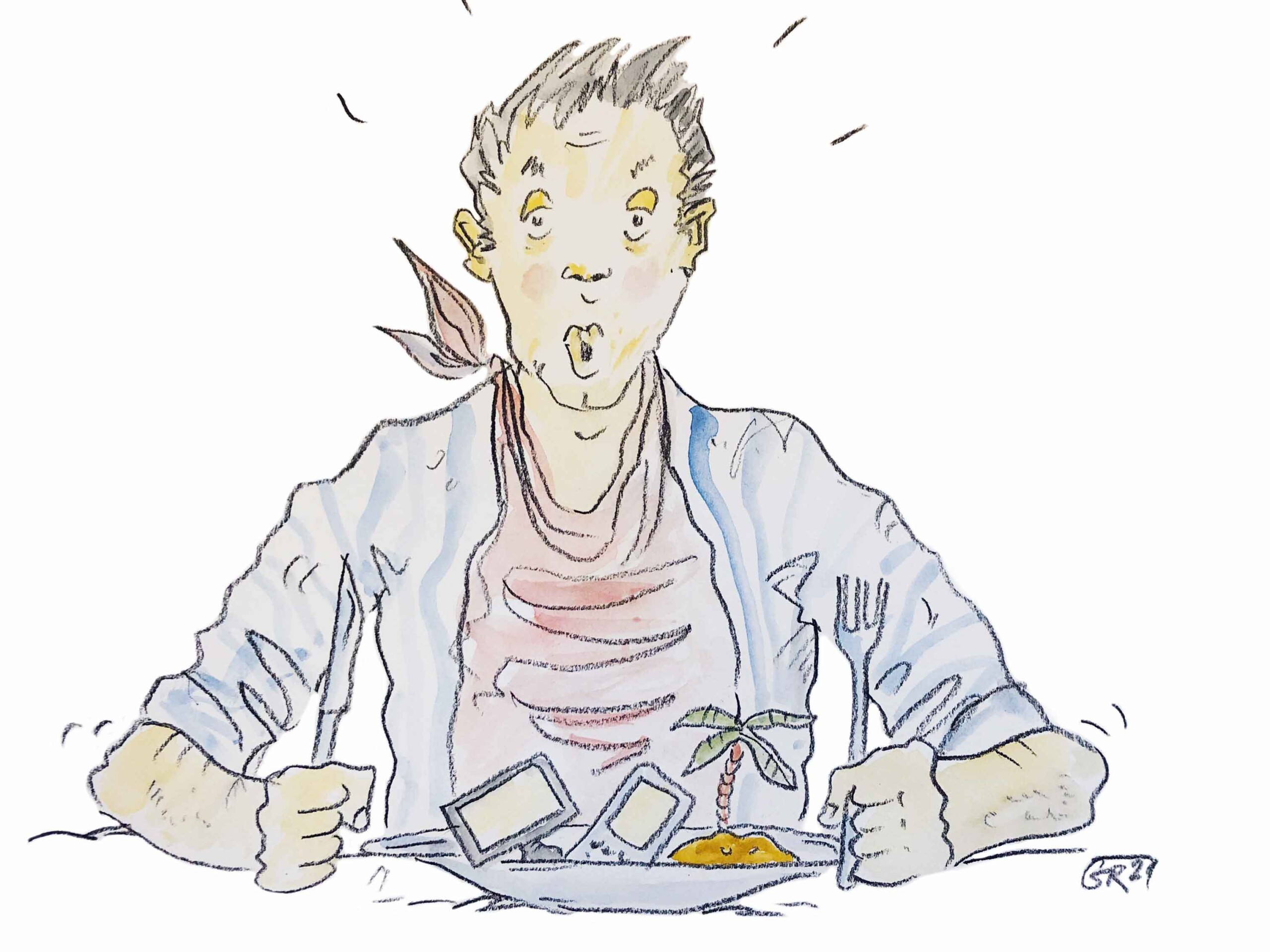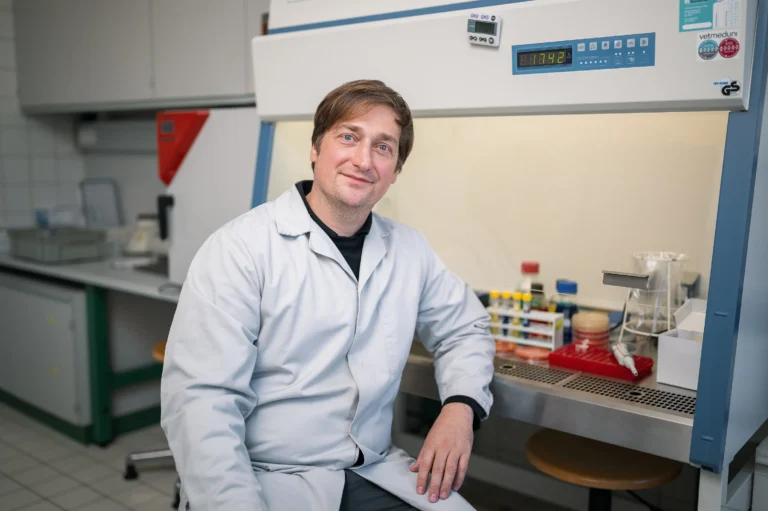Wer wissen will, wie unsere Konsumgesellschaft funktioniert, muss die Spielregeln der Experience-Economy kennen. Ein Einkaufsbummel zwischen Erfahrung und Erlebnis.
Ganz ohne Krisen wäre das Leben ziemlich langweilig, oder? Ganz ohne Katastrophe, die einen zum Innehalten, Umdrehen oder Abbiegen zwingt, ganz ohne Knackpunkt, an dem etwas wegbricht, ganz ohne Kapitulation vor dem Üblichen – wenn also alles so ist, wie es immer schon war: Ein solches Dasein wäre weniger beruhigend als irgendwann trostlos und fad.
Es muss ja nicht gleich der totale Kollaps sein, aber irgendein „belehrendes Erlebnis, das Erkenntnis zu einer Sache einbringt“ und einen aktiv werden lässt – das wäre im Sinne des Fortschritts schon wünschenswert.
Ein „belehrendes Erlebnis, das Erkenntnis zu einer Sache einbringt“ also: Das muss einem auch erst einmal einfallen, wenn man versucht „Erfahrung“ zu definieren. Anonymen Intellektartisten ist es eingefallen. Und sie haben Wikipedia damit gefüttert, jenes digitale Museum des Allgemeinwissens, das alles weiß, wenn man selbst nicht mehr weiterweiß. Der Museumsbesuch entführt einen in ein weites Land der Erkenntnis. Man lernt, dass „Erfahrung“ sich vom Mittelhochdeutschen „ervarunge“ ableitet, was so viel wie „Durchwanderung“ oder „Erforschung“ bedeutet. Diese Forschungsreise führt weiter ins Englische, wo man bei „Experience“ landet, womit sich der semantische Raum von der „Erfahrung“ aufspannt Richtung „Erlebnis“, sich also beide Bedeutungen – das Erkenntnishafte und das Ereignishafte – miteinander verbinden.
An diesem Punkt: Raus aus dem Kopfigen, rein ins Konkrete: „Experience“ – was ist das? Wer braucht’s? Was bringt’s?
Auf der Suche nach Antworten landet man beim amerikanischen Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi, der Ende der 1990er-Jahre ein Buch mit dem Titel „Flow: The Psychology of Optimal Experience“ herausgibt. Darin beschreibt er das Gefühl, das Höchstleister wie Manager, Mütter oder Marathonläufer gut kennen: Sie empfinden ihre Anstrengung, ihre Mühen auch als lustvoll, weil sie Erfüllung bringen. Sie sind während ihres Tuns im „Flow“.
Leistung, so Csikszentmihalyis daraus destillierte Theorie, macht glücklich. Zunächst übertitelt er sein Denkmodell mit „autotelic experience“, abgeleitet vom griechischen Wort „Autotelos“. Kennt niemand, versteht keiner, beschreibt aber einen Zweck, der in der Aktivität selbst liegt: Man macht Musik um des Spielens willen und nicht, damit man hinterher Musik gemacht haben wird. Später nennt Csikszentmihalyi dieses völlige Aufgehen in einer Tätigkeit einfach „Flow-Theorie“. Kennt man, versteht man.
Menschen, die „im Flow“ sind oder „einen Flow (in Deutsch am ehesten: einen Lauf) haben“, fragen nicht, wie spät es ist, sie vergessen ihre Umwelt, ob sie schon gegessen haben und dass sie für heute Abend eigentlich ein Treffen ausgemacht hatten. Sie merken die Anstrengung nicht und nicht das Egomanisch-Nerdige ihres Tuns. Sie folgen einem Leistungstrieb, der unsere Evolution geprägt hat – nämlich sich mit einer vorhandenen Mangelsituation nicht abzufinden, sondern triebhaft nach einer Lösung zu suchen. Sie haben eine unstillbare Neugier, zumindest aber keine Angst vor Anstrengung und keine Abneigung gegenüber Leistung. Dafür braucht es eine gewisse Einstellung und Überzeugung, was die Mühen bringen: Erfüllung – eine Experience.
Neben diesem Schaffensaspekt gibt es aber auch die Nutzerperspektive. In unserer spätpubertären Form des Kapitalismus, in der wir trotzig immer noch mehr wollen und uns einen feuchten Stiefel darum kümmern, ob vernunftbegabtere Zeitgenossen vor einer Ausbeutung des Globus oder den Grenzen des Wachstums warnen, reicht das banale Wirkungsdreieck Kaufen-Haben-Nutzen nämlich schon lange nicht mehr. Um sich von der nüchternen Bedürfnisbefriedigung abzugrenzen und als hedonistisches Genussprojekt zu glitzern, braucht der Konsum einen Zusatzfaktor: Erlebnis – eine Experience.
Das führt ziemlich schnurgerade in eine eigene Spielart der Ökonomie: zum Begriff der Experience-Economy – im Deutschen Erlebnis-Ökonomie. Erstmals taucht er 1998 in Arbeiten der beiden amerikanischen Wissenschafter Joseph Pine und James Gilmore auf. Deren These: Die Wirtschaft hat sich von einer Dienstleistungsökonomie zu einer Erlebnisökonomie entwickelt. In dieser neuen Wirtschaftsära müssen Unternehmen demnach nicht nur qualitativ hochwertige Produkte produzieren, sondern dafür sorgen, dass den Kunden mit dem Produkt auch ein unvergessliches Erlebnis als Mehrwert geboten wird.
Ist ein Angebot erst einmal mit einer tollen Story hinterlegt, kann sich das Gesamtpaket zu einem trendigen Umsatztreiber entwickeln. Kann – muss aber nicht. Zahllos sind die präsumtiven Bestseller, die es nie über den Status eines Rohrkrepierers hinaus geschafft haben, weil statt Erlebnis Enttäuschung mitgeliefert wurde.
Schuld daran ist nicht selten die Globalisierung. Sie schmilzt Exklusives zu Massenware ein, Besonderes zu Banalem, Luxusware zu Billigramsch, weil sich immer irgendwo irgendjemand auf der Welt findet, der es günstiger (nach-)macht. Das mag überspitzt formuliert sein, ist aber eines der Funktionsmuster der weltweit verbandelten und optimierten Konsumindustrie. Dafür muss man nicht Softwareentwicklungen wie Cloud-Dienste oder Online-Shopping-Plattformen als virtuelle Zeugen vorladen, es reicht ein Blick aufs eigene Konsumverhalten: Man kauft alpine Trachtenhemden bei der schwedischen Billigmodekette, Werkzeug und Küchenartikel chinesischer Markennachbauprofis beim Lebensmitteldiskonter.
„Einspruch!“, könnte man an dieser Stelle rufen. „Wo ist zwischen Wühlbergen und Regalgassen die hochgelobte Consumer-Experience?“ Stimmt. Joseph Pine nennt diesen Heißhunger nach anonymer Massenware im Schatten der Experience Economy einen „Begleit-Trend“: Auf der einen Seite wollen Kunden manches zum niedrigstmöglichen Preis in kürzestmöglicher Zeit einkaufen, auf der anderen Seiten möchten sie ihr hart verdientes Geld aber in Erlebnisse investieren, die exklusiv und alles andere als billig sind. Sie bleiben erlebnisgierig – trotz „Geiz ist geil“-Mentalität.
Das macht es für die Erlebnis-Anbieter nicht einfacher. Es reicht nicht mehr, hervorragende Produkte zum besten Preis und exzellenten Service anzubieten. Das kann dank globalisierter Warenströme und weltweit verfügbare Technologie die Konkurrenz auch. Es braucht ein einzigartiges Kauf-Abenteuer als Unterscheidungsmerkmal.
Die Experience-Economy wird zum Dienstleistungstheater: Mitarbeiter, die etwas verkaufen wollen, stehen auf der Bühne, der Kunde ist – bevor er zum Käufer wird – Publikum, das es mit einem möglichst guten Stück zu überzeugen gilt. Diese Customer Experience endet aber nicht an der Kasse mit einem vollgefüllten Warenkorb, sondern geht nach dem Bezahlen auf beiden Seiten der Bühne weiter. Die Dienstleister analysieren die digitale Körpersprache ihrer Kunden. Aus dem Kaufverhalten erstellen sie Kundenprofile, um beim nächsten Theaterbesuch ein personalisiertes Stück nach Vorliebe des Kunden anbieten zu können. Scoring nennt man diese Bewertung und Gewichtung von Interaktionen zu einem Datenprofil. Die Käufer wiederum füttern Bewertungsportale von Preis- und Suchmaschinen, posten und teilen ihre Erlebnisse auf Social Media-Plattformen.
An jedem einzelnen Berührungspunkt wird die Customer Experience in Daten umgewandelt. „What gets measured, gets managed“ – was gemessen werden kann, wird gemessen und genutzt – lautet die Prämisse. Das mag verstören, als veritable Krise unseres Konsumverhaltens, als Kollaps selbstbestimmten Handelns oder einfach nur als „Katastrophe!“ tituliert werden. Aber in Wahrheit ist es nur Ergebnis eines Erlebnisses, nach dem sich Kunden mehrheitlich sehnen. Eine bittere Erfahrung vielleicht. Jedenfalls aber eine Experience.
Illustration: Gernot Reiter