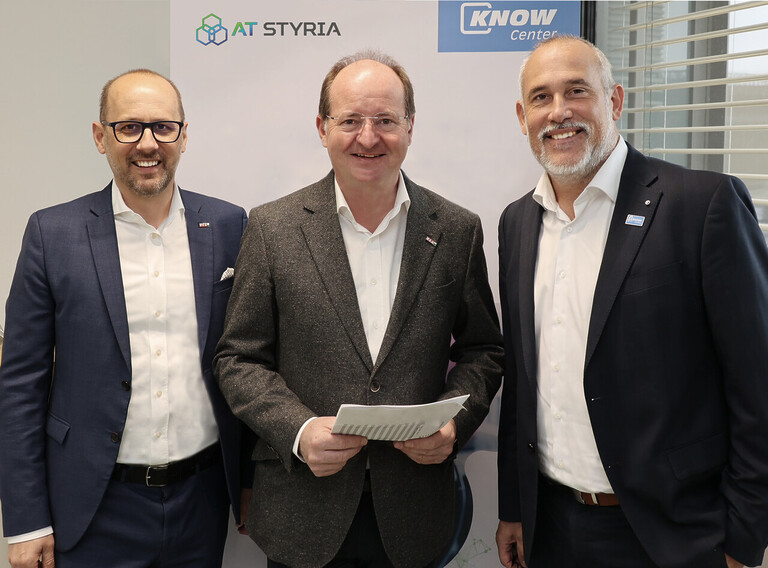In einem Interview mit Herbert Ritter, dem Vizepräsidenten der WKO Steiermark, geht es um das Thema Versorgungssicherheit in Österreich. Insbesondere wird diskutiert, welche Strategien notwendig sind, um die langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dabei wird auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 und den Ausbau erneuerbarer Energien in Österreich eingegangen. Herr Ritter betont, dass die Erhöhung der Erzeugungskapazitäten mit der notwendigen Leitungsinfrastruktur und Speichermöglichkeiten einhergehen muss. Der Beinahe-Blackout Anfang des Jahres zeigte, wie verwundbar die europäische Netzinfrastruktur ist. Des Weiteren wird diskutiert, wie realistisch das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 für die energieintensive Industrie ist und was gegen die Abwanderung von Betrieben getan werden kann. Dabei wird auch die Rolle der EU-Kommission bei der Einführung von Grenzausgleichsmechanismen für CO2-intensive Produkte aus Drittstaaten besprochen. Insgesamt wird betont, dass attraktive investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für erneuerbaren Projekte notwendig sind, um den heimischen Standort attraktiv zu halten.
Herr Vizepräsident, müssen wir uns Sorgen um die Versorgungssicherheit für die heimischen Betriebe machen?
Herbert Ritter: Ich denke, es wäre besser, sich intensiv mit dem Thema Versorgungssicherheit zu beschäftigen und kluge Strategien auszuarbeiten und auch umzusetzen, als sich zu lange damit aufzuhalten, sich Sorgen zu machen.
Was braucht es denn, um die Versorgungssicherheit langfristig gewährleisten zu können?
Wir haben uns zum Ziel gesetzt bis 2040 klimaneutral zu werden und schon im Jahr 2030 Strom zu 100 % (bilanziell) aus erneuerbaren, heimischen Energiequellen zu beziehen. Obwohl Österreich mit 79 % erneuerbarem Strom im EU-Vergleich Spitzenreiter ist, stellt dieses 2030-Ziel eine enorme Herausforderung dar und setzt einen massiven Ausbau an Erzeugungskapazitäten voraus. Die heimischen Stromnetze sind für diese Energiewende aber noch nicht gerüstet. Im Gleichschritt mit der Erhöhung unserer Erzeugungskapazitäten dürfen wir daher keinesfalls die notwendige Leitungsinfrastruktur und die Speichermöglichkeiten vernachlässigen. Der Beinahe-Blackout Anfang des Jahres sollte uns in diesem Zusammenhang als Weckruf dienen, denn er hat uns vor Augen geführt, wie verwundbar die europäische Netzinfrastruktur ist.
Stichwort Klimaneutralität bis 2040 – wie realistisch ist dieses Ziel für die energieintensive Industrie?
Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint eine gänzliche Substituierung von fossilen Energieträgern, allen voran fossiles Gas, innerhalb der nächsten 19 Jahre als eher unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viel versprechende Verfahren zur Herstellung von sauberem Wasserstoff, die aber nur durch einen deutlich höheren Effizienzgrad Marktreife erlangen werden. Um in diesem Bereich Investoren anzulocken, braucht es einen klaren und transparenten gesetzlichen Rahmen. Deshalb warten wir schon gespannt auf den Entwurf der EU-Kommission zum Wasserstoff- und Gasdekarbonisierungspaket. Erst wenn für grundlegende Fragen im Zusammenhang mit der Wasserstofferzeugung und -Infrastruktur Rechtssicherheit besteht, werden Investitionen in größerem Ausmaß getätigt. Aber Klimaneutralität bis 2040 wird ja bekanntlich nicht nur für den Industriesektor angestrebt. Daher stellt sich für mich auch die Frage, wie realistisch die Substitution von knapp einer Million Gasheizungen bis 2040 und über 600.000 Ölheizungen bis 2035 erscheint.
Viele Industriebetriebe sind schon in Länder abgewandert, in denen günstiger produziert werden kann. Was kann dagegen getan werden?
Da Betriebe in Drittstaaten weder dem EU-Emissionshandelssystem noch nationalen CO2-Bepreisungen unterliegen, ist es nur logisch, dass viele aus wirtschaftlichen Überlegungen und zur Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit im internationalen Wettbewerb an einen kostengünstigeren Produktionsstandort abwandern, sogenanntes Carbon-Leakage. Denkt man diese Entwicklung zu Ende, bedeutet dieses Carbon-Leakage nicht nur eine ökonomische Katastrophe für Europa, sondern auch aus ökologischer Sicht eine absolute Katastrophe. Denn nirgends wird Stahl, Zement oder Papier klimaschonender produziert als in Europa und im Speziellen in Österreich. Beispielsweise emittiert China bezogen auf die Wirtschaftsleistung viermal so viel CO2 wie Österreich.
Werden die sogenannten CBAMs der EU-Kommission das Problem der Abwanderung nicht lösen können?
Natürlich braucht es Grenzausgleichsmechanismen für CO2-intensive Produkte aus Drittstaaten, jedoch werden „Strafzölle“ das Problem nicht so einfach lösen. Unsere Maßnahmen werden Gegenmaßnahmen auslösen, welche wiederum einen großen Schaden für die in Drittstaaten exportierenden Betriebe bedeuten.
Was braucht es aus Ihrer Sicht, um den heimischen Standort attraktiv zu halten?
Wenn wir unsere Klima- und Energieziele ernst meinen und tatsächlich eine Vorreiterrolle im Klimaschutz und im Bereich der sauberen Energien einnehmen wollen, dann müssen wir unbedingt investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für „Erneuerbaren-Projekte“ schaffen. Dazu braucht es eine Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes, um die Genehmigungsverfahren zu verkürzen und so den Standort attraktiver zu machen. Es kann nicht im Sinne des Erfinders sein, dass Projektwerber mit Verfahrensdauern von mehreren Jahren und finanziellen Belastungen konfrontiert sind.
Warum wird die Wirtschaft oft stark kritisiert für ihre Rolle im Kampf gegen den Klimawandel?
Oft und gerne wird die heimische Wirtschaft in der Klimadebatte als Verhinderer und Bremser, teils sogar als rückständiger Dinosaurier abgetan. Ich denke diese Darstellung wird unseren Betrieben keineswegs gerecht. Im Gegenteil: In Europa und speziell in Österreich wurden massive Schritte gesetzt, um die Dekarbonisierung voranzutreiben. Am Ende des Tages sind es gerade die Unternehmen, von denen die innovativen Lösungen zur Ermöglichung der Klimaziele erwartet werden. In vielen Bereichen haben wir die Technologieführerschaft. Um diese Erwartungshaltung weiterhin erfüllen zu können, ist es unsere Pflicht von der Politik realistische Ziele einzufordern.