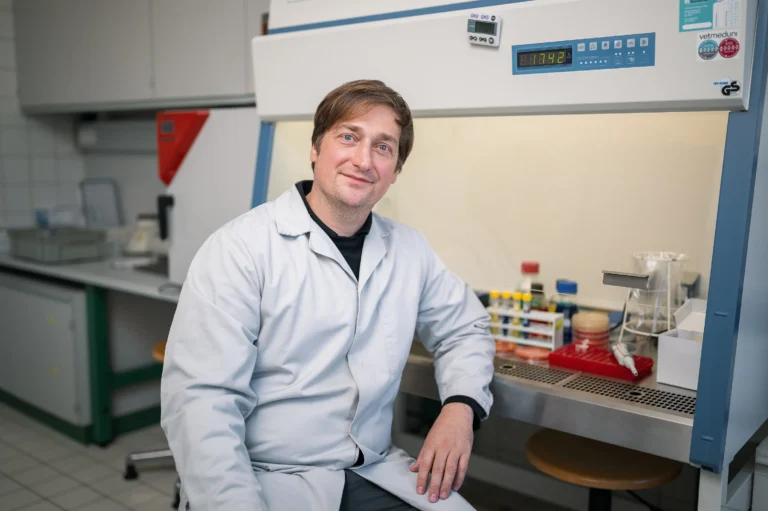„No risk, no fun“, heißt es. Aber just in unserer Spaßgesellschaft verkümmert die Risikobereitschaft. Das ist nicht nur feig, sondern fad.
Wer ist mutiger? Sie, die trotz rigider Religionsvorschrift ihre Haare nicht unter einem Schleier versteckt. Er, der ohne Seilsicherung eine senkrechte Felswand hinaufklettert. Die, die in kleinen Schlauchbooten am offenen Meer gegen Walfangflotten kämpfen. Jene, die ihr Heimatland gegen einen Aggressor verteidigen. Du, der/die es schafft, endlich über den eigenen Schatten zu springen. Wir, die wir trotz diverser Kandidaten und Parteien nicht den Glauben an die Demokratie verlieren. Mut lässt sich nicht vergleichen.
Auch ein Kramen in Sammlungen und Stochern in Erinnerungen archivierter Mut-Momente führt zu keinem klaren Ranking. Da ist der unbekannte Mann, der sich nur in Hemd und Hose und mit Aktentasche in der Hand im Juni 1989 einem anrollenden Panzer am Tian’anmen-Platz in Peking entgegenstellt. Da ist Sophie Scholl, die im Widerstand gegen das Naziregime 1943 Flugzettel druckt und verteilt, oder Nelson Mandela, dessen unnachgiebiger Kampf gegen die Apartheid ihn lange Jahre ins Gefängnis brachten. Da ist der kleine David, der sich im Alten Testament nicht vor der Kampfmaschine Goliath versteckt. Da ist Christoph Kolumbus, der 1492 aufbrach, um unbekannte Welten – oder zumindest Indien – zu entdecken (und in Amerika landete). Da sind Demonstranten, die seit Jahrhunderten in Diktaturen gegen Despoten, Diskriminierung und andere Derivate der Unterdrückung protestieren. Da ist das tapfere Schneiderlein, das mit wackeligem Herz und märchenhafter List durchs Leben „abenteuert“. Mut ist ein Resultat situativer Risikobereitschaft, manchmal ein Kind der Wut, manchmal die Folge von Ärger. Aber vergleichen lässt er sich nicht.
Lässt er sich überhaupt definieren? Was ist Mut eigentlich? Wenn man innere Vernunftschranken überwindet und von einer Felsklippe ins Wasser springt? Durch einen dunklen Wald spaziert? Sein weinendes Kind erstmals im Kindergarten zurücklässt? Den sicheren Job kündigt? Und was unterscheidet Mut von Courage? Letztere scheint die zivilisiertere Form der Unerschrockenheit zu sein, eine sympathischere Art der Beherztheit als jene bockstarren Rambo-Attitüden, die Mut mit möglichst monströser Muskelmasse gleichsetzen. Courage ist wohl die raffiniertere Form, Schneid zu zeigen, ohne gleich zum Schwert zu greifen. Beides – Mut und Courage – lässt sich jedenfalls nicht kaufen, aber trainieren. Denn Mut ist wie ein Muskel: Bleibt er ungenutzt, bildet er sich zurück. Bis nichts mehr davon übrig ist. Aus der bisweilen übertriebenen Angst, hinzufallen, wird so die Unfähigkeit zu gehen. „Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“, bilanziert der Volksmund treffsicher.
Gerade in schwankenden Zeiten, in denen Unsicherheiten und Krisen einen aus der Balance zu kippen drohen, schadet es aber nicht, am Weg nach vorne Zweifel gegen Zuversicht zu tauschen – und sich mehr zu trauen. Und zuzutrauen. Dafür müsste man aber manchmal das sichere Terrain des Wissens verlassen und sich aufs glatte Eis der Wagnis begeben. Das mag nicht jeder. Lieber Vollkasko als volles Risiko. Die Zukunft ist aber grundsätzlich kein Grund zur Panik. „Mutig in die neuen Zeiten, (…) arbeitsfroh und hoffnungsreich“ – diese Handlungsanleitung für ein (be)glückendes Leben steht sogar in der Bundeshymne, Strophe drei. Blöd halt, dass wir nie so weit kommen, weil wir lieber über große Söhne und Töchter streiten. Wohl aus Angst vor der eigenen Courage. Oder weil wir lieber wissen, statt zu wagen.
Bedenken da, Befürchtungen dort, Bremsfallschirme allerorts. Wie Zwangsjacken hüllen Verlust- und Versagensängste das eigene Entfaltungspotenzial ein. Aber mit schlotternden Knien lässt sich in stürmischen Diskussionen kein Standpunkt vertreten, mit zittrigen Händen keine Chance beim Schopf packen. Ja, es braucht einen gegenwindresistenten Glauben an sich selbst. Nein, es braucht nicht erst wirtschaftliche Unabhängigkeit und Freiheit, um mutig sein zu können. Das würde alle Furcht‑, aber Mittellosen diskreditieren, die gegen Unrecht auf die Barrikaden klettern. Aber nein, man braucht umgekehrt auch nicht Pleitier zu sein und nichts mehr zu verlieren zu haben, bis man Kopf und Kragen riskieren kann.
„Weil’s eh scho’ wurscht is“ oder „du in deiner Position hast leicht reden“: Beide Ausreden greifen nicht, weil es bedeuten würde, dass Angst- und Zwangsfreiheit erst gelingt, wenn man zu viel oder nichts mehr hat. Das ist zynischer Schrott. Mut ist kein Exklusivauftrag für Arme oder Superreiche. Couragiertes Handeln funktioniert auch im medianen Wohlstand. Wenn da nicht diese Bequemlichkeit wäre, dieses träge Sattheitsgefühl, dieser Nährboden für eine nach allen Seiten abgesicherte Langeweile. Warum daran etwas ändern? Wofür mutig sein? In unserer Wohlstandswohlfühlwellnessgesellschaft braucht es keinen Mut, um zu überleben. Grenzen ausloten? Dafür gibt es sicher eine absturzsichere App. Zukunft wagen? Der Slogan findet sich auf Wahlplakaten, aber selten im eigenen Leben. Sich trauen? Maximal vor dem Standesamt, und dann nur mit der verbrieften Möglichkeit zur Scheidung. Sicher ist sicher.
Was ist da passiert? Wann hat sich der Mut aus unserem Alltag verflüchtigt und ist zum Alleinstellungsmerkmal von Extremsportlern geworden, die sich in Wingsuits aus Flugzeugen werfen, ungesichert überhängende Abgründe hochklettern oder mit Skiern senkrechte Bergflanken runterfahren? Wann ist die Courage aus dem Dasein verschwunden, die einen nicht immer alles gut finden lässt, nur weil es alle gut finden. Die einen Widerspruch gegen Chefs wagen lässt, einen bei Konflikten eingreifen statt wegschauen lässt, einen bei Unfällen helfend zupacken statt hilflos hinstarren lässt? Mittlerweile braucht es sogar zwei Paragrafen im Strafgesetzbuch, die einen dazu ermahnen und verpflichten, im Notfall anzupacken. Immerhin drohen beim „Imstichlassen“ eines Verletzten Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren beziehungsweise bis zu einem Jahr, wenn es um „unterlassene Hilfeleistung“ geht. Fehlende Courage ist also ein Strafdelikt. Das sagt mehr über den Zustand einer Gesellschaft aus als jede vermeintliche Mutprobe in einem Abenteuerpark. Aber Sicherheiten aufgeben und Unsicherheiten in Kauf nehmen oder Bewährtes infrage zu stellen gehört eben nicht gerade zur Stärke unseres Kulturkreises. Im Gegenteil – auch wenn die Eigenwahrnehmung ganz eine andere ist.
So haben in einer Studie der Max-Planck-Forschungsgesellschaft, bei der Testpersonen mit einem Betrugsversuch konfrontiert wurden, vorab alle angegeben, sich in einer relevanten Situation einzumischen. In der Praxis tat das dann aber maximal ein Viertel. Zudem zeigte sich: Die Menschen, die von sich sagen, sie würden entschieden eingreifen, sind nicht die Leute, die aktiv werden. Dagegen sind die Menschen, die tatsächlich eingreifen, nicht jene, die sich für besonders mutig halten. Diese Diskrepanz gründe, sagen Psychologen, im Unterschied zwischen „affektivem Mut“, also einem Handeln aus einem plötzlichen Impuls heraus, und „rationalem Mut“, bei dem dem Eingreifen ein nüchternes Abklären von Für und Wider, Einsatz und Erfolgsaussicht vorangeht. Wenn-dann-Kausalitäten als Kompass für die eigene Kühnheit: Ob das reicht?
Wie jemand reagiert, hängt aber nicht nur von der jeweiligen Situation ab, sondern vor allem auch vom Wertegerüst, das ab frühester Kindheit vermittelt wird und wie ein Skelett des Charakters wirkt und das spätere Leben prägt. Lernt man bereits in jungen Jahren, authentisch zu sein, die Wahrheit zu sagen, Herausforderungen anzunehmen, auch mal schwierige Situationen durchzuhalten und diese letztendlich zu bewältigen, wirkt sich das auf den Mut aus, sagt die Motivationsforscherin Michaela Brohm-Badry, Professorin für Lernforschung und langjährige Dekanin des Fachbereichs Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Philosophie und Psychologie an der Universität Trier.
„Jeder kann zu einem Menschen werden, der Erfolg will, die Möglichkeit des Scheiterns zurückstellt und sich durch viele Mutproben solch ein Selbstbewusstsein erworben hat, dass er sagt: „Ich schaffe das“, bestätigt Psychologe Siegbert Warwitz. Es gebe aber auch Menschen, die den Misserfolg fürchten, die davon ausgehen, zu scheitern, es nicht zu schaffen – die die Gefahr und nicht den Gewinn sehen. „Wie wir werden, entscheiden wir mit. Wir tragen beide Anlagen in uns“, so Warwitz. Doch wie viel Mut ist das richtige Maß? Hat man zu wenig, ortet man schnell Kleinmut oder gar Feigheit. Ist man zu forsch, verbindet sich tollkühnes Handeln schnell mit Übermut und Hochmut. Dann kann es tatsächlich gefährlich und destruktiv werden. Die Grenze zwischen Mut und Dummheit ist und bleibt nämlich ein schmaler Grat. Ob eine Entscheidung mutig oder visionär ist oder einfach nur schwachsinnig, kann fast nie im Moment des Geschehens beurteilt werden, sondern erst wesentlich später.
Man sollte Mut also mit Durchhaltevermögen kombinieren, mit Sturheit und Selbstvertrauen, sein Tun mit ein bisschen mehr Besessenheit und ein bisschen weniger Feigheit garnieren. Denn Mut und Courage blühen nur dort, wo Angst und Panik verwelken. Vielleicht lohnt es sich, sich Erfinder, Entdecker oder kleine Kinder zum Vorbild zu nehmen. Sie scheitern oft, verirren sich häufig, fallen immer wieder hin. Bis dann der große Durchbruch, die ultimative Innovation oder die ersten Schritte gelingen. Sie haben Erfolg, weil sie sich nicht entmutigen lassen, nicht aufgeben und weitermachen. Bis es irgendwann klappt. Den Mutigen gehört die Welt.
Illustration: Gernot Reiter