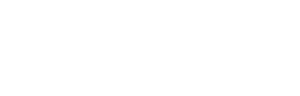Wie kommt das Neue in die Welt? Eine vielstrapazierte Frage. Das allgegenwärtige Antwortinventar erschöpft sich in partiellen Definitionsversuchen, semantischen Annäherungen, halbhellen Aspektbeleuchtungen. Die umfassende Erklärung, wie eine Innovation – also jenes Neue, das eine positive Veränderung verspricht – den Weg in die Wirklichkeit findet, gibt es aber nicht.
Die menschliche Schaffenskraft ist diesbezüglich auf zu verschlungenen Pfaden unterwegs, um geradlinige Narrative zuzulassen. Zu viele unvorhersehbare Zufälle, Regel- und Tabubrüche begleiten einen Kreativprozess, bis daraus etwas Innovatives entsteht. Zu viele Irrungen und Wirrungen werden durch den Glanz und das Gewinnversprechen der wenigen Ideen zugedeckt, die tatsächlich Gamechanger-Qualitäten haben. Denn Innovation ist stets eine Wette auf zukünftiges Nutzerverhalten und deshalb immer riskant. Die meisten Innovationsversuche scheitern daher. Sie schaffen keine Brücke zwischen den Parallelwelten des wohlbekannten Heute und des unbekannten Morgen.
Abgesehen davon: Wie viel tatsächlich Neues steckt im Neuen wirklich? Denn streng – also beim Namen – genommen, ist auch eine Innovation nur ein Mix aus bereits bestehenden Zutaten. Alter Wein in neuen Schläuchen? Das lateinische Verb „innovare“ bedeutet ja „nur“ erneuern, nicht erfinden. Gepanschter Wein noch dazu?
Weiter bringt einen nur ein Abschied von der apodiktischen Wortklauberei. Denn auch eine Collage aus existierenden Einzelteilen kann einen eigenständigen Charakter entwickeln. Jeder Cocktail in einer Bar beweist das. So bleibt die Innovation ein Vorgang, der durch Anwendung neuer Verfahren, die Einführung neuer Techniken oder der Etablierung erfolgreicher Ideen einen Bereich, ein Produkt, einen Prozess oder eine Dienstleistung erneuert, erschafft oder zumindest auf den neuesten Stand bringt.
Wir brauchen das. Unsere Gesellschaft braucht das. „Wir setzen auf neue Technologien, um Mobilität und gesellschaftlichen Wandel angesichts der Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen; wir erproben neue Formen der Achtsamkeit und des Umgangs mit uns selbst, um vielfältigen psychischen Belastungen spätmoderner Gesellschaften, wie Burnout, Depression oder Einsamkeit zu begegnen. Wir hoffen auf neue, kreative politische Lösungen, um drängende Probleme und andauernde Konflikte zu lösen oder doch mindestens zu entschärfen. Und wir suchen, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, beim Konsum, auf Reisen, in den Sozialen Medien oder im Museum vor allem nach dem Neuen, dem Singulären und Besonderen“, liefert die Theaterwissenschaftlerin Doris Kolesch eine präzise Beschreibung dieser Sucht nach dem Neuem, diesem Hunger nach dem Unbekannten.
Wir streben im avantgardistischen Sinn nach Räumen, die noch nicht begangen sind, nach Lösungen, die davor noch nie gefunden wurden, nach Produkten, die unsere Bedürfnisse auf neue Art stillen – oder es schaffen, unsere Wünsche nicht nur zu wecken, sondern sogar neue Begehrlichkeiten zu schaffen. Wie das heutzutage funktioniert? Wenn die Innovation mit entsprechenden Glücksversprechen vermarktet wird – dem Wachsen von Flügeln beispielsweise. 1984 Jahre seit Christi Geburt und noch ein paar Jahrtausende menschlicher Urgeschichte davor, hat es der Homo sapiens eigentlich recht locker geschafft, ohne Energydrinks zu überleben. Heute gilt ein synthetischer Saft aus einer Aludose als Vademecum. Allein 2022 wurden weltweit 11,582 Milliarden Dosen Red Bull verkauft, ein Plus von 18 Prozent gegenüber 2021. Verrückt!
Erklärbar ist das auch mit einer Nebenwirkung von gelungenen Innovationen, für die gerade unsere Konsumgesellschaft anfällig ist: eine in Kaufimpulse umgeleitete Neugier, die von hocheffizienten Marketingstrategien gnadenlos aufbereitet und ausgeschlachtet wird. So wird es möglich, dass wir (uns) Sachen (ver)kaufen, von denen man uns erst erklären muss, wozu sie eigentlich zu gebrauchen sind beziehungsweise was sie an Mehrwert bringen. Für bestimmte Genussartikel, neue Maschinen, digitale Technologien etc. müssen die Nutzer erst entsprechend vorbereitet, also innovationsbereit gemacht werden. Von daher müsste man die Frage, wie Neues in die Welt kommt, umformulieren: Wie sind Welt und Mensch mit dem bereits existierenden Neuen kompatibel?
Manchmal sind sie es gar nicht. So lassen die in immer kürzeren Zeitabständen aufeinanderfolgenden Krisen, die sich potenzierenden Risiken unserer Wirtschafts- und Lebensweise eine Reihe von Verdachtsmomenten aufkommen: Ist das Neue vielleicht nicht immer zwangsläufig das Bessere, vielleicht ist diese Gleichsetzung nur Blendwerk? Braucht es die Krise als abgemilderte Form der Katastrophe, um Erneuerungsprozesse in Gang zu setzen? Wie viel Festhalten am Rhythmus von vorgegebener Ordnung, festem Regelwerk und fixierter Methodik verträgt die Grundmelodie der Hypermoderne? Wie viel Kreativität als Motor gesellschaftlichen Wandels, künstlerischer Innovation und wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts sind noch gesund? Ab wann wird Innovation toxisch?
Grundsätzlich ist die Versessenheit nach dem nie Dagewesenen freilich eine Wurzel des Fortschritts unserer Optimierungsgesellschaft. In ihr herrscht ein Imperativ der Beschleunigung, ein steter Versuch, Neues zu erschaffen. Überall werden Innovationen eingemahnt, Initiativen gegründet, Programme gestartet, die Zukunftsfähigkeit garantieren sollen. Das entfacht eine Innovationsdynamik, die die Moderne auszeichnet, sie aber gleichzeitig fast an sich selbst scheitern lässt. Denn Innovation ist ein zähes Unterfangen, die erwünschten, erwartetet oder erhofften Veränderungen gibt es nicht zum Nulltarif.
Innovation bedeutet vielmehr die Bereitschaft zu beständiger Infragestellung und zum Experiment. Das heißt auch, die Forderung nach Interdisziplinarität und Kreativität ernst zu nehmen und den Mut zum Irrtum zu haben. Wenn sich etwas ändern soll, kann nicht zugleich alles bleiben, wie es immer war. Wer Innovation wirklich will, darf die Revolution nicht scheuen. Chaosvermeidung? In Zeiten epochaler Umbrüche ein aussichtsloses Unterfangen. Wir bewohnen heute nämlich parallel eine Vielzahl von Realitäten, die zunehmend den Kontakt zueinander verlieren. Wir leben im digitalen Zeitalter, sind aber strukturell und gedanklich vielfach noch gefangen im Industriezeitalter. Wir bewässern mit Subventionsgießkannen abgewirtschaftete Felder, während vielerorts die Innovationskeimlinge verdursten. Wir bestreiten einen von Verunsicherung, Skepsis, Angst und Pessimismus geprägten Alltag, der stattdessen Begeisterung, Leidenschaft, Ausdauer und Zuversicht bräuchte. Auch und gerade für das Neue.
Zwar soll Isaac Newton die Idee zu seinen bahnbrechenden Fallgesetzen gekommen sein, als er unter einem Baum lag und den Äpfeln beim Herunterfallen zusah. Für gewöhnlich kommen Innovationen aber nicht wie der Blitz in die Welt. Es braucht das passende Klima im Brutkasten, aber auch später, beim Heranwachsen der Ideen zu erfolgreichen Geschäftsmodellen. Was dabei hilft, ist ein unverrückbarer Fokus auf den Nutzer und seine tatsächlichen Probleme, Bedürfnisse und Wünsche. Es ist nämlich ein großes Missverständnis, die digitale Transformation für technologiegetrieben zu halten. Die Technologie ist wichtig, ja, aber sie ist nicht der Ausgangspunkt. In erster Linie gehe es laut Apple-Gründer Steve Jobs um die Nutzererfahrung, von der ausgehend rückwärts bis zur Technologie gearbeitet werden muss. Nur so schafft man nachhaltigen Mehrwert.
Die rasante Entwicklung in Kommunikations- und Computertechnologie bietet eine Blaupause für die Bipolarität dieses Fortschritts. Einerseits zeigt die Netzwerkökonomie den unmittelbaren Nutzen erfolgreicher Innovation im digitalen Zeitalter, indem sie systemischen Wert schafft. Als Leitformel gilt das Metcalfesche Gesetz, wonach sich der Nutzwert insbesondere sozialer Netzwerke im Vergleich zur Anzahl seiner Benutzer verdoppelt, während die Kosten nur linear zur Teilnehmerzahl steigen. Das ist ertragreicher Humus.
Andererseits geht die durch die Innovation möglich gewordene Massenkommunikation verschwenderisch mit der Aufmerksamkeit ihrer Nutzer um. Zugleich Ideal und Schreckensvision dieses Phänomens scheint die Zeitrafferreise zu sein: Mit fortwährend wachsender Geschwindigkeit rast man an den Dingen vorbei, bestaunt das stichflammenartig entstehende Neue im Sekundentakt und kann es doch niemals fassen. Ein innovativer Rahmen als Durchlauferhitzer für Info-Fast-Food ohne sättigenden Nährwert. Neues kommt so zwar am Fließband in die Welt, ohne sie aber zu innovieren. Schade eigentlich.
„Wo ist das Wissen, das wir durch die Information verloren haben?“, fragte der britische Dichter T. S. Eliot besorgt. Das war 1934. Ob wir 90 Jahre später eine Antwort finden? Es wäre eine echte Innovation.