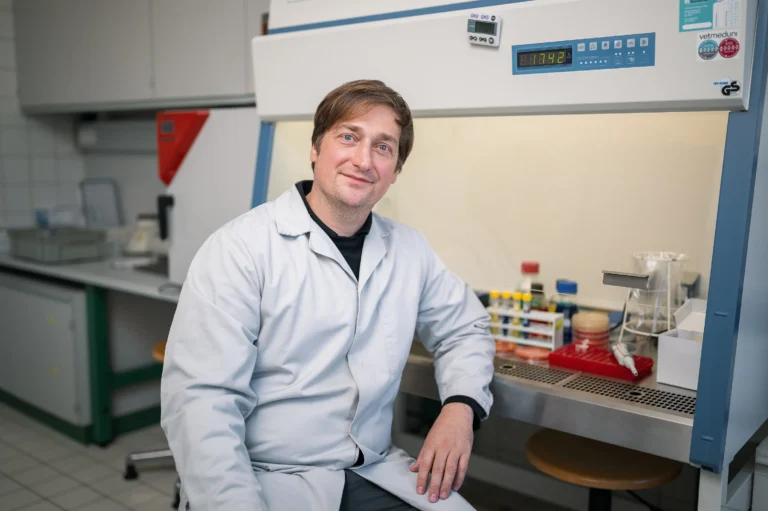Friede ist mehr als die Abwesenheit von Gewalt und die Anwesenheit eines Yogalehrers. Für den Einzelnen wie auch für eine Gemeinschaft bleibt es ein vielschichtiger Versuch, Zu-FRIEDEN-heit zu finden.
Zumindest eines ist klar: So kann es nicht weitergehen! Krawalle, Proteste, Unruhen und jetzt auch noch ein handfester Krieg haben in den letzten Jahren ein zunehmend düsteres Bild unserer Welt geprägt. Es ist aber nicht nur die Anwesenheit von Gezank und Gewalt, die verstört. Auch das Aufblühen von Integrationsproblemen, das Erodieren der Mittelschicht, die Expansion einer wild in alle Richtungen expandierenden Desorientierung und der wuchernde Moralverlust in allen sozialen Schichten befeuern die Abkehr vom „Friede, Freude, Eierkuchen“-Ideal.
„Kriminelle Manager, die auf Staatskosten Milliarden verzocken und Millionenabfindungen bekommen, Kleinbetrügereien bei der Steuererklärung, tagtägliche Egoismen im Straßenverkehr“, liefert der deutsche Philosoph Richard David Precht Beispiele für den Sittenverfall im Alltag. Was nach Aktualität klingt, ist zwölf Jahre alt. Von wegen „früher war alles besser“. Damit wackeln sämtliche Stützpfeiler eines Friedens im ganzheitlichen Sinn. Wobei: So richtig fest waren die noch nie ins Fundament der menschlichen Gesellschaft gerammt.
Vielleicht ist das mit dem Pazifismus ohnehin ein historischer Irrtum. Gewagte These. Aber man würde prominente Kronzeugen finden. „Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen! Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“ Vielen würde man diese Kampfparole wohl zuschreiben. Dass sie sich im Matthäus-Evangelium als Zitat von Jesus wiederfindet, überrascht dann doch einigermaßen. Das Disharmonische verstört, überrascht, regt zum Nachdenken und zur Interpretation an. Durch die paradoxe Intervention könne „eine Bereitschafft zur Dekonstruktion erzeugt werden, eine Ermutigung, die Fiktion unserer harmonischen Wirklichkeit aufzugeben“, versucht es beispielsweise der Psychotherapeut Michael Lehofer.
Krieg also um des – ohnehin nur imaginierten – Friedens Willen? „Si vis pacem, para bellum”: „Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor“, wussten schon die alten Römer. Zweitausend Jahre später hielt ein gewisser John Lennon dem bellizistischen Motto einen friedensbewegten Kontrapunkt entgegen. „Imagine all the people, livin’ life in peace“, sang er erstmals vor exakt 51 Jahren, im September 1971. Schon damals wusste er aber um die hohe Wahrscheinlichkeit der Aussichtslosigkeit dieses Gedankens: „You may say I’m a dreamer …“
Andererseits: Träumen wird man ja wohl noch dürfen. Dieser zivilisatorische Impuls ist Gesellschaften westlichen Zuschnitts systemimmanent implementiert. Kein Schaden. Denn solche Träume helfen bei den Versuchen die Menschheit zu verbessern und sie trösten, damit man nicht vollends an der Wirklichkeit verzweifelt. Anlässe böten sich zur Genüge. Konflikte lodern allerorts. Das Blöde dabei: Die Frontlinien verändern sich zum Teil rascher als H&M seine Fast — Fashion-Kollektionen tauscht. Damit wird es reichlich unübersichtlich.
Gut – oder besser – gar nicht gut: Es gibt sie noch, die Kriege alten Zuschnitts, wo der klar definierte Feind jenseits einer Grenze sitzt, sei es eine politische, eine geografische, eine religiöse oder ethnische. Nicht weniger gefährlich sind aber die Bruchlinien, die sich durch durchmischte Milieus schlängeln wie eine Kreuzotter durch eine zerklüftete Karstlandschaft. Da schleichen sich dann schnell neue Kampfbegriffe ein, die wie Standarten durch die Schlacht der Argumente getragen werden. „Moral“ ist so ein Wort, „Werte“ ein anderes. Mit „Feminismus“-Fahnen könnte man auch winken und umgehend „Mansplaining“-Plakate entgegengefuchtelt bekommen.
Viele dieser Tugenden sind Grundzutaten eines allumfassenden sozialen Friedens, einige auch Sollbruchstellen. Manche sind mittlerweile von der tiefer werdenden Schlucht zwischen Arm und Reich bereits verschluckt worden. Eine Gesellschaft am Abgrund? Zumindest werden sich Milieus ohne Tugenden ausbreiten. „Eure Werte, euer sozialer Friede und eure Moral sind uns scheißegal!“ – dieser rüde Protest füttert politische Ränder, radikalisiert das gesellschaftliche Klima, zerstört den sozialen Frieden.
Derartige den gesellschaftlichen Boden unterspülende Entwicklungen waren in den vergangenen Jahren in vielen EU-Staaten zu beobachten. Es handelt sich dabei sowohl um kurzfristig auftauchende Phänomene wie etwa Ausschreitungen in verschiedenen europäischen Großstädten als auch um mittel- und langfristige Tendenzen wie die steigende Politikverdrossenheit, wachsende Arbeitslosigkeit oder demografische Entwicklungen, die eine hohe Dynamik aufweisen. So sprach der damalige britische Premierminister David Cameron im Kontext der Krawalle im August 2011 in England von einer „kaputten Gesellschaft“. Wie lässt sie sich reparieren?
Man könnte es wieder in der Liedwerkstatt von John Lennon versuchen: „Imagine all the people, sharing all the world.“ Ein bisschen mehr „Wir“, ein bisschen weniger „Ich“ – das sollte am Ende nicht nur den gesellschaftlichen Frieden stabilisieren, sondern auch zu mehr innerem Frieden führen. Eine Vision? „You may say, I’m a dreamer …“ Vielleicht. Aber schaden würde eine beruhigte Seelenlandschaft in aufgewühlten Zeiten wie diesen jedenfalls nicht. Die Rezepte, die dafür angeboten werden, sind bunt, die Bandbreite der Autoren reicht von Religionsgründern bis zu Yogalehrern, von Psychologen bis zu Drogendealern.
Schnell lässt sich an diesem Punkt die Gesellschaftskritik Richtung zukunftsvergessenem Materialismus und gegenwartsverliebtem Egozentrismus lenken. Die Wirtschaft benötige schließlich einen egoistischen Hedonisten und unersättlichen Konsumenten, der nie zufrieden und disziplinlos ist in seiner Gier nach mehr, seziert der amerikanische Soziologe Daniel Bell das System. Es ist das Wertedilemma westlicher Gesellschaften, denn zur Sicherung des inneren Zusammenhalts brauchten sie gleichzeitig einen bescheidenen Mitbürger, hilfsbereit und zufrieden.
Dieser Spagat wird zur inneren Zerreißprobe. Und geht sich irgendwann nicht mehr ohne Konflikt aus. Denn je zweckrationaler die Menschen ihren Nutzen kalkulieren, umso ungesünder wird das gesellschaftliche Klima. Zunächst werden die Moralreserven verbraucht, später kracht es irgendwann. Frieden, adieu! Erster Verwundeter in derartigen Auseinandersetzungen ist der Gemeinschaftssinn vulgo Solidarität. Es ist das Ergebnis des ewigen Konflikts zwischen Liberalismus und Demokratie. Denn während die Idee des Liberalismus der individuellen Freiheit verpflichtet ist, basiert die Idee der Demokratie auf einer weitreichenden Gleichheit. Hier eine Balance zu finden, wird zunehmend schwierig.
„Eine Zeit lang hatte die Demokratie eine Aura des Unausweichlichen“, schrieb die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright vor über einem Jahrzehnt. „Das ist vorbei“, konstatierte sie schon damals. Die Welt stehe nicht mehr in der Auseinandersetzung von Kommunismus und Kapitalismus, „sondern zwischen Demokratie und Autokratie“. Im Spiegel der aktuellen Ereignisse hat das etwas beängstigend Prophetisches. Die Demokratie scheint zunehmend im Stich gelassen zu werden, was nicht zuletzt die abstürzenden Wahlbeteiligungen bezeugen. Wenn das so weitergeht, wird die Demokratie – und damit eine Friedensgarantie – allmählich verkümmern.
So konserviert sich der ewige Kampf für Gerechtigkeit und gegen die Gleichgültigkeit als Übung mit schmalen Erfolgsaussichten. Damit bleibt auch das Streben, Frieden zu finden – mit der Außenwelt, seinen Wertvorstellungen und sich selbst – eine der größeren Herausforderungen im Leben. Die Gefahr, sich in seinem eigenen Verhaltenslabyrinth zu verirren, wird nämlich immer größer. „Wir sind zu gut informiert, um uns noch zu klaren Weltanschauungen zu bekennen, zu liberal, um Wertehierarchien zu formulieren, zu konsumorientiert, um Bescheidenheit zu predigen“, so Philosoph Richard David Precht.
„Erst kommt das Fressen, dann die Moral“, bringt es Bertolt Brecht in seine „Dreigroschenoper“ auf den Punkt. Dass das eher auseinanderdividiert als zusammenschweißt, dafür braucht es kein Psychologiestudium. Die Lust auf Bindung statt Vereinzelung als ein wesentliches Fundament für gesellschaftlichen Frieden, schmilzt. Sportvereine, Kirchen, Gewerkschaften merken das, auch Parteien. Stattdessen gibt es eine Projektmentalität. Man engagiert sich durchaus, möchte das aber nur für eine gewisse Zeit tun, dann ein neues Abenteuer beginnen. Langfristiges passt nicht in einen derartigen Lebensentwurf. Damit wird auch Zu-Frieden-heit zu einem flüchtigen seelischen Aggregatzustand. Vielleicht lässt sich damit die zunehmende Brüchigkeit des Friedens erklären.
Überall Konflikte mit dem Arbeitgeber, Krisen mit dem Partner, Kriege mit irgendeinem Feind. Da bleibt wenig Platz für Frieden. Als Notausgang vor dem depressiven Jammertal könnte man versuchen, der Nacht ein wenig Sonne abzutrotzen. Denn Kriege haben im Schatten ihres Zerstörungsfurors immer auch als Fortschrittstreiber funktioniert. Meist freilich zu einem viel zu hohen Preis. Aber eine Gesellschaft, will sie krisenfest sein und Frieden stiften können, braucht auch eine gewisse Konfliktfähigkeit. Streiten, aber richtig – das müsste man können.
Menschen dagegen, die sich durch eine ausgesprochene Harmoniebedürftigkeit auszeichnen, stiften in verschiedensten Situationen gerade dadurch Unfrieden. Es ist die spannungsgeladene Dialektik des Friedens, Drogen nicht ganz unähnlich: Ein Überdosis Glückshunger kann ins Unglück führen. „Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann“, lehrmeistert diesbezüglich ein altes Sprichwort. Ein Dilemma? Vielleicht. Aber eines bleibt klar: So kann es nicht weitergehen!
llustration: Gernot Reiter