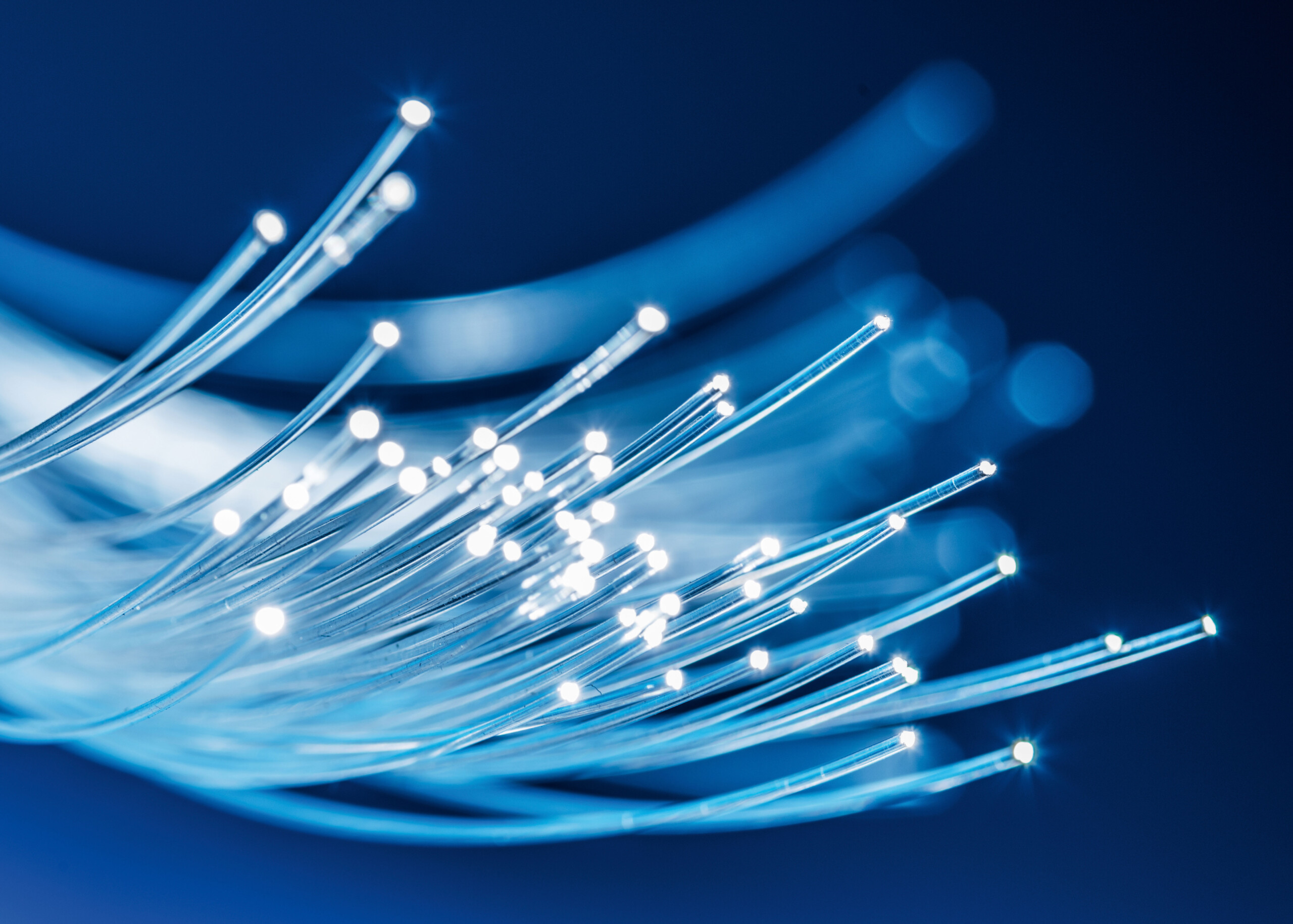Forschung und Entwicklung sind die unabdingbare Voraussetzung für Innovationen. Auch die steirischen Kompetenzzentren tragen auf vielen verschiedenen Gebieten zur Bereitstellung immer neuer Innovationen bei. Echte Innovationsbremse ist der Fachkräftemangel, vor allen an Technikern fehlt es. Und die Datenautobahnen sind bei Licht besehen bestenfalls Rumpelpisten – Glasfaser ist in Österreich noch Utopie.
Die äußerst hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind der wohl wichtigste Innovationsmotor für den Wirtschaftsstandort Steiermark. Jahrelang hat die Steiermark im Konzert der europäischen Regionen die erste Geige gespielt, was F&E angeht. Zuletzt musste sie ihren Spitzenplatz zwar abgeben, ist mit einem F&E‑Anteil von 4,91 Prozent des Bruttoregionalproduktes immer noch unter den Top-Playern der EU. Der leichte Rückgang der steirischen F&E‑Quote ergibt sich in erster Linie aus dem starken Wirtschaftswachstum und dem dadurch gestiegenen Bruttoregionalprodukt. In absoluten Zahlen sind die Ausgaben für F&E von 2015 bis 2017 nämlich sogar gestiegen – von 2,23 auf 2,32 Milliarden €.
Die Forschungslandschaft in der Steiermark kann sich international sehen lassen. Innovationsbooster sind neben den Universitäten und den Forschungsabteilungen vieler Firmen vor allem die zahlreichen Kompetenzzentren. An 25 der 44 Kompetenzzentren in Österreich ist die Steiermark beteiligt. 15 dieser Zentren befinden sich im Bundesland. Vom virtuellen Fahrzeug über Polymerforschung bis zur Mikroelektronik reichen die Gebiete, in denen an den Zentren geforscht wird.
Wie rege und erfolgreich die Entwicklungstätigkeit der steirischen Unternehmen ist, lässt sich Jahr für Jahr an Innovationswettbewerben ablesen. Die steirischen Betriebe sind fix gesetzt, wenn es um die Auszeichnungen für innovative Produkte geht.
Äußerst gut unterwegs sind auch die Universitäten. So ist die Technische Universität Graz zwar nur rund halb so groß wie die TU Wien, was die Zahl der Studierenden und Lehrenden angeht. Dennoch lukriert sie um 50 Prozent mehr private Forschungsmittel als der Wiener Mitbewerber.
Leider gibt es auch einige Innovationsbremsen. Manche davon sind europaweit zu spüren, andere davon rein hausgemacht. Wie viele andere Regionen Europas auch leidet die Steiermark an einem Fachkräftemangel. Gesucht werden vor allem Arbeitskräfte mit einer MINT-Ausbildung – also in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Menschen mit entsprechender Ausbildung stehen alle Türen offen.
Der Fachkräftemangel in der Steiermark wird nicht abnehmen, im Gegenteil. Österreich und damit unser Bundesland stecken in einer demografischen Falle. Während die Zahl an Jugendlichen immer mehr abnimmt, gehen gerade die die geburtenstarken Jahrgänge der „Baby-Boomer“ in Pension oder befinden sich bereits im Ruhestand. Bis zum Jahr 2030 – also in nur elf Jahren – werden in der Steiermark mehr als 50.000 Menschen im Haupterwerbsalter zwischen 20 und 60 Jahren fehlen, ein nicht geringer Teil von ihnen in der Industrie.
Trotz der ausgezeichneten Karrierechancen im technischen Bereich setzen viele junge Menschen aufs falsche Pferd. So sind die beliebtesten Studienrichtungen in Österreich Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Psychologie. Und das, obwohl mehr als ein Drittel der rund 30.000 arbeitslosen Akademiker Juristen sind. Maschinenbauer oder Prozesstechniker hingegen werden mit dem sprichwörtlichen Schmetterlingsnetz gesucht. Von der Montanuniversität Leoben geht die Saga, dass die Absolventen mancher Studienrichtungen Blanko-Arbeitsverträge zugeschickt bekommen, in die sie nur mehr Namen und Gehaltswunsch eintragen müssen. Das ist natürlich übertrieben, ein wahrer Kern steckt dennoch in der Erzählung.
Eine andere Innovationsbremse ist ein eher österreichisches Phänomen: die völlig unzureichende Infrastruktur bei der Datenübertragung. Während andernorts zügig am Ausbau des Glasfasernetzes gearbeitet wird oder bereits weite Teile der Betriebe und Haushalte mit dieser schnellen Datenleitung ausgestattet sind, fühlt man sich hierzulande in die Anfangszeiten des Internets versetzt.
Ein paar Zahlen der OECD von 2018 zum Vergleich: Südkorea ist Spitzenreiter, was der Anteil der Glasfaseranbindung bei den stationären Breitbandanschlüssen angeht. Dieser liegt in dem südostasiatischen Land bei 78,5 Prozent. Die europäischen Top 3 sind Litauen mit 72,1 Prozent Glasfaseranschlüssen, gefolgt von Lettland mit 66 Prozent und Schweden mit 64,3 Prozent. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 24,8 Prozent.
Österreich findet sich hingegen auf den allerletzten Plätzen wieder. Der Glasfaseranteil liegt bei lächerlichen 2,3 Prozent. Unterboten wird das nur noch vom Vereinigten Königreich mit 1,5 Prozent, Belgien mit 0,6 Prozent und Griechenland mit 0,2 Prozent. Dass die Wirtschaftssupermacht Deutschland beim Glasfaseranteil ebenfalls bei 2,6 Prozent herumgrundelt, ist kein Trost.
Während die Datenmengen, die übertragen werden müssen, immer größer werden, geschieht bei den dafür nötigen Leitungen wenig bis gar nichts. Die vielbeschworene Breitbandmilliarde konzentrierte sich eher auf Kupferleitungen, die eine theoretische Übertragungsrate von zehn Gigabit pro Sekunde erlauben. Zum Vergleich: Glasfaser ermöglicht theoretisch einen Datendurchfluss von 30.000 Gigabit pro Sekunde.
Die Hoffnung, dass der kommende neue Mobilfunkstandard 5G eine Verbesserung bringen wird, ist trügerisch. Denn die theoretische Übertragungskapazität liegt mit zehn Gigabit pro Sekunde nur gleichauf mit den ohnehin vorhandenen Kupferleitungen. Dazu kommt, dass das 5G-Netz noch nicht einmal installiert, geschweige denn in Betrieb ist. Und bis das 5G-Netz einmal steht, wächst das gesamte Datenvolumen rasant weiter.
Eine schnelle Datenübertragung ist nicht nur essenziell für alles, was mit Forschung und Entwicklung zu tun hat, sondern auch eines der Kernelemente der Industrie 4.0. Die Fertigung maßgeschneiderte Produkte mit geringen Losgrößen erhöht natürlich die Menge der benötigten Daten erheblich. Alle halbherzigen Modernisierungsmaßnahmen bleiben so zwangsläufig ein Hinterherhecheln hinter der Entwicklung.