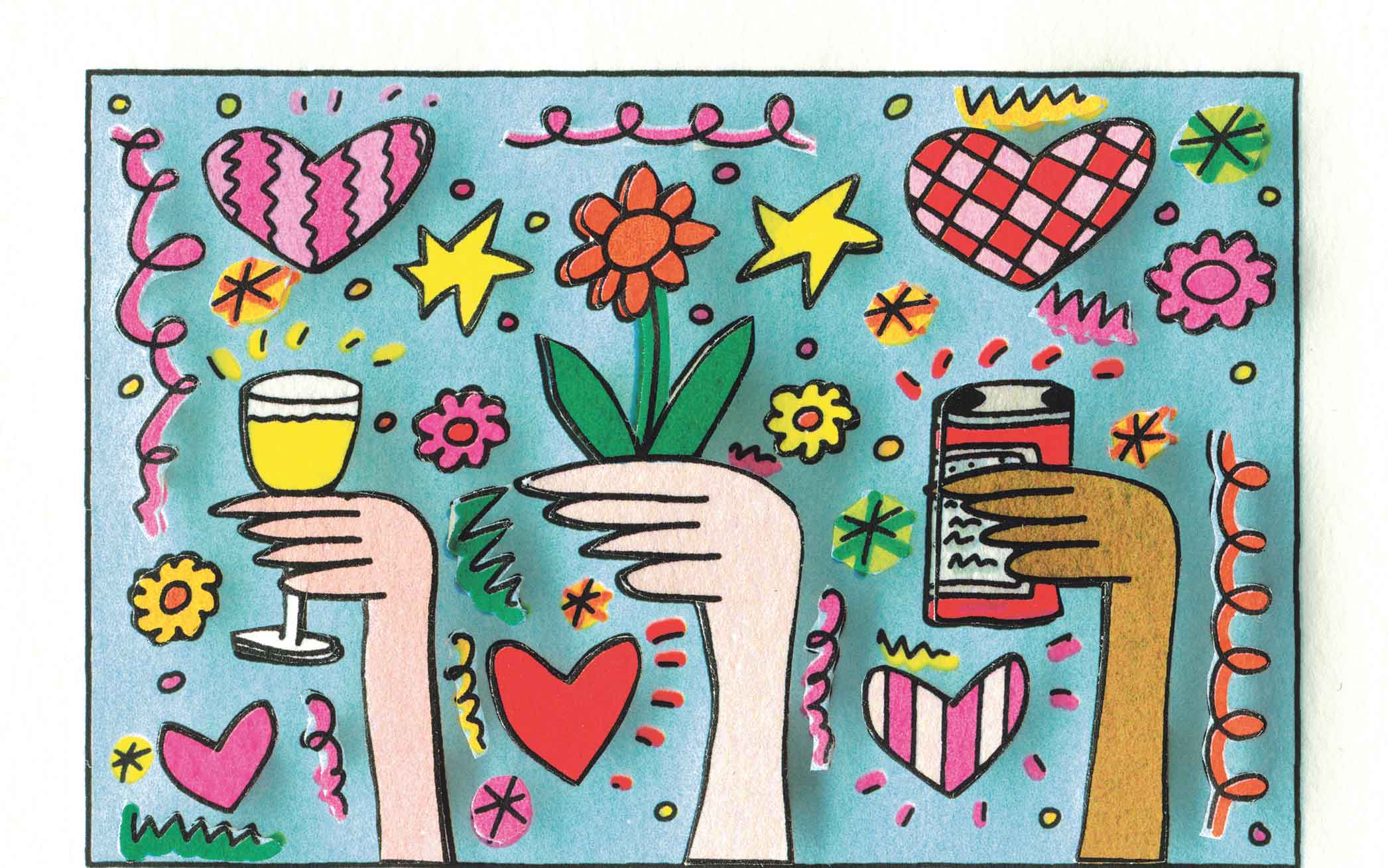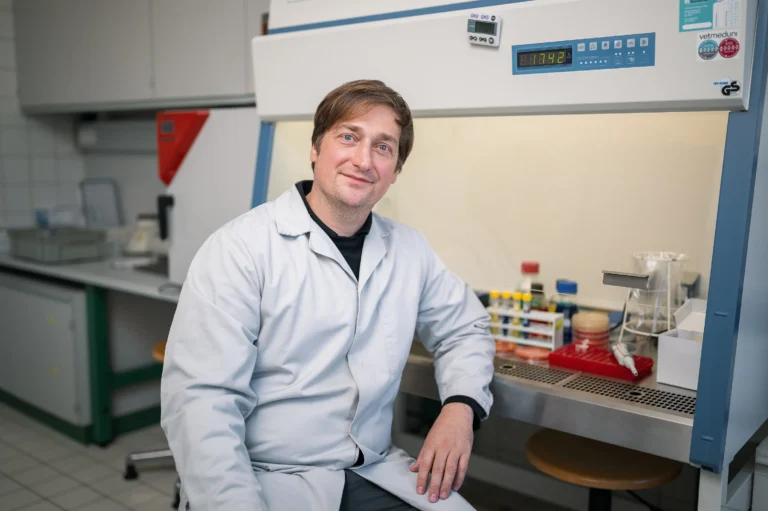Alle wollen es, kaum einer weiß, wie man es erreicht: Glück – diese ungreifbare Mischung aus Sehnsüchten, Erinnerungen und einem Verlangen nach Harmonie und Happiness. Wie aussagekräftig sind einschlägige Statistiken oder Operetten-Weisheiten?
Krieg, Krise, Klimakatastrophe: Darf man in Zeiten wie diesen überhaupt von Glück sprechen? Oder soll man es gerade wegen der düsteren Alltagskulisse? In einer Gesellschaft, die sich das Raunzen und Nörgeln als USP-Etikett aufgeklebt hat, bleibt der Raum für flächendeckende Lebenszufriedenheit jedenfalls auch in Friedenszeiten eng. Irgendeine Form von Unglück lauert ja immer irgendwo. Und dann hat man es „ja eh immer schon gewusst“, dass „das sicher nix wird“ oder „net passt“, weil’s „ja ka’ Wunder is’“. Um umgekehrt dem Unglück dennoch wenig Angriffsfläche und Möglichkeit zur Ausbreitung zu bieten, jammert man sich mit einer schwammigen „Des passt scho“-Zufriedenheit durchs Leben. Gemäß der Alltagsbewältigungsregieanweisung der legendären Tante Jolesch, wonach „Gott einen vor allem hüten soll, was noch ein Glück ist“.
Dieses angeborene Talent für Tristesse spiegelt sich auch in einer sprachlichen Eindimensionalität wider. Denn im Österreichischen wird alles unter dem Holdingdach „Glück“ generalisiert und subsummiert, wo in anderen Sprachen zwischen Zufallsglück und Glückseligkeit diversifiziert und differenziert wird. So unterscheidet man im Lateinischen zwischen „Beatitudo“ oder der „Fortuna“, im Französischen zwischen „Bonheur“ und „Chance“, zwischen „Eudaimonia“ und „Eutychia“ in der griechischen Philosophie und „Happiness“ und „Luck“ im Englischen.
Nur im Deutschen ist es semantisch einerlei. Hier spricht man immer nur von „Glück“ – egal, ob es sich um glückliche (Zufalls-)Momente, einen richtigen Lottotipp oder einen sturmfreien Beziehungsalltag handelt. Auch wenn darunter ein ganzheitlich geglücktes Lebensmodell verstanden wird, das sich frei von Nöten, Zwängen, dem Ballast der Geschichte und der Angst vor der Zukunft entfalten kann, spricht man von Glück.
Es ist eine wirre Gemengelage aus konstant geglückter Gestaltungskraft und der Unkäuflichkeit und Unplanbarkeit von Zufallsglück. Linguisten sprechen ob der Ungenauigkeit von einem sogenannten „Kaugummiwort“: Nimmt man es in den Mund, lässt es sich in alle Richtungen dehnen, zu Blasen formen, durch Lücken pressen, zerkauen und zermahlen.
Praktisch wird die Generalisierung dagegen, wenn es um die großzügige Weitergabe dieses nicht erzwingbaren, aber erstrebenswerten Zustands geht. Wir wünschen einander Glück und erhalten Glückwünsche zu Weihnachten, Neujahr, zu Geburtstagen, zu Hochzeiten, auch für Aufgaben, die vor uns stehen und die uns gelingen sollen. „Viel Glück!“ – damit ist alles gemeint, was Zufriedenheit verspricht. Man weiß aber um die vogerlhafte Flüchtigkeit des Glücksmoments. Um auf „Nummer sicher“ zu gehen, werden daher Heilsversprechen und Heldengeschichten erzählt, die ein Leben in Glück versprechen; Symbole bemüht, um dem Augenblick seine Vergänglichkeit zu nehmen. Maskottchen, Talisman oder Amulett, Hufeisen, vierblättrige Kleeblätter oder Marienkäfer, Rauchfangkehrer oder Marzipanschweine: Das Glücksbringer-Repertoire aus Insignien des Aberglaubens ist bunt, kitschig und kommerzparfümiert. Glück als hoffnungsgesteuertes Konsumgut. Die Idee dahinter: Riskiert man ausreichend Einsatz, ließe sich das Glück praktisch erzwingen. Casinos leben davon. Pyramidenspiele und die Börse ebenso.
Aber auch abseits von Pokerkarten, einarmigen Banditen und Hedgefonds wird eifrig versucht, die Welt in ein Wellnessstudio und die Gesellschaft in eine Funcommunity zu verwandeln, damit die individuelle Glücksfindung gelingt. Die Menschen ergeben sich dabei dem Formatierungsdruck und dem Imperativ der Selbstoptimierung. Der gemeinschaftliche Ansatz, Glück gewährende Rahmenbedingungen für möglichst viele zu schaffen, findet dagegen immer seltener Mehrheiten. Glück als soziale Grundtonart verstummt. Dafür wird die Angst – ein natürlicher Feind des Glücks – lauter. Das hat zwar den Touch von Kultur-pessimismus, lässt sich aber auch zur Motivationsformel umwandeln. „Je weniger Angst, desto mehr Glück“ – das taugt zur Alltagsbewältigung und hilft beim Wahrnehmen jener emotionalen Eindrücke, die glücklich machen sowie der Verbreitung von Happiness für möglichst viele Menschen.
Das wussten schon die Gründerväter der USA. Zu den bereits 1776 in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung niedergeschriebenen „unveräußerlichen Menschenrechten“ gehört demnach „the pursuit of happiness“ – das Streben nach Glück. Auch dabei geht es um mehr als die Glücksjagd Einzelner. Nämlich um ein – natürlich idealisiertes – politisches und gesellschaftliches Konzept. Dass es nebstbei der Treibstoff für einen bisweilen zügellosen Kapitalismus mit all seiner Gier und seinen Schattenseiten ist, darf freilich nicht verschwiegen werden. Denn dass mit wirtschaftlichem Wachstum nicht zwingend ein Plus am subjektiven Wohlbefinden-Konto verbucht wird, beweist China. Die Einkommen haben sich dort in den vergangenen drei Jahrzehnten verdreifacht. Und die Zufriedenheit innerhalb der Gesellschaft?
Zwar wird zwischen Peking und Shanghai mittlerweile auch individuelles Verhalten im Alltag nach einem Punktesystem beurteilt, eine Gemütszustandsmessung wie beispielsweise jene in Australien oder die „World Database of Happiness“ der Universität Rotterdam fehlt allerdings. Letztere bündelt weltweite Daten zur Lebensqualität. In einer Art Hitparade der Nationen bezüglich der durchschnittlichen „Happiness“ (als Synonym für Lebenszufriedenheit) führt für den Erhebungszeitraum 2010 bis 2019 Dänemark vor Mexiko, Kolumbien und der Schweiz. Österreich rangiert auf Platz 12. Am unteren Ende der 160 erfassten Staaten liegen Burundi und Tansania.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt der vor zehn Jahren initiierte „World Happiness Report“ der Vereinten Nationen. Damit soll der Zustand des weltweit empfundenen Glücks und der Lebenszufriedenheit erhoben und daraus auch politische Folgerungen abgeleitet werden. Bewertet werden unter anderem die wirtschaftliche Lage, der soziale Zusammenhalt, die Lebenserwartung und die Verbreitung von Korruption. Traditionell liegen in diesem Ranking die skandinavischen Länder an der Spitze – zuletzt Finnland vor Dänemark. Österreich rangiert rund um Platz 10, Bhutan scheint in der jüngsten Liste gar nicht auf.
Das kleine, dicht bewaldete Königreich im Himalaya wurde lange als Glücks-Supermacht bestaunt. Das dort vom König erfundene „Bruttosozialglück“ aus seelischem Wohlbefinden, klaren Regeln für Wirtschaft und Gesundheit, Förderung von Umweltschutz und Bildung wurde schnell zur sozialen Leitwährung und zum monopolhaften Entwicklungsindikator. Das ambitionierte Ziel lautete: Die Menschen von Bhutan sollen zu den glücklichsten der Welt gehören. Als eklatante Schwäche des Modells gilt allerdings, dass die Gewichtung der einzelnen Indikatoren undurchschaubar ist und das Ergebnis vor allem international nicht vergleichbar ist, weil der Index nur in Bhutan ermittelt wird. Auch in Australien gibt es einen Sonderweg. Dort wird schon seit zwanzig Jahren der „Australien Unity Wellbeing Index“ erhoben, eine Art nationaler und persönlicher Glückswetterbericht. Vermessen werden sieben potenzielle Hauptverbreitungsgebiete von Glück im Privaten sowie gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang: Beziehung, Lebensstandard, Lebensziel, Gesundheit, Gemeinschaftssinn, persönliche Sicherheit und eine allgemeine Zukunftserwartung.
Das Ergebnis gibt einen tiefen Blick in die Entwicklungskurve der australischen Seele – und wie sich beispielsweise die Finanzkrise, Buschfeuer, Covid oder die Markteinführung des iPhone auf den persönlichen und gesellschaftlichen Gefühlshaushalt, auf Zufriedenheit und Glücksempfinden und damit auf die Lebensqualität ausgewirkt haben. Wie würde eine derartige Happiness-Matrix wohl bei uns aussehen?
Und geht das überhaupt? Lässt sich Glück messen? Kann man emotionale Empfindungen auf einer rationalen Punkteskala festmachen? Reicht es, der Unwirtlichkeit der Wirklichkeit einer chronisch verunsicherten Gesellschaft eine lifestyle-buddhistische individuelle „Ruhe-in-deiner-Mitte“-Harmonie entgegenzustellen und alles wird gut? Lässt sich Happiness gar in Saftpackerl abfüllen, wie die Aufschrift eines heimischen Fruchtsaftherstellers vollmundig verspricht? Oder stimmt der Ansatz aus Johann Strauß’ Operette „Die Fledermaus“, wonach „glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist“? Kann man nur im und durch Vergessen und Verdrängen glücklich werden? Das würde zu Österreich passen, könnte man ketzerisch anmerken. Allgemein gültiger und verträglicher erscheint aber Bobby McFerrins Ansatz: „In every life we have some trouble / but when you worry you make it double“. Sein Fazit: „Put a smile on your face“ und vor allem „Don’t worry, be happy!“ Klingt nach einem Plan.
Illustration: James Rizzi