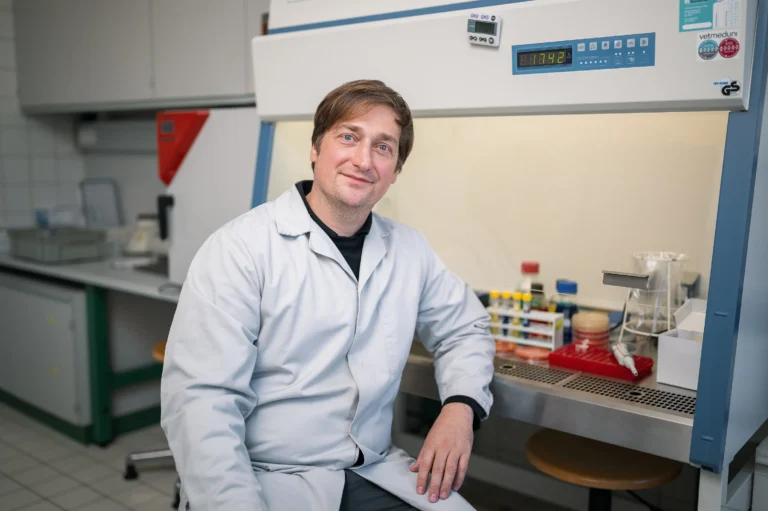Die Digitalisierung schreitet in großen Schritten voran und während zahlreiche Innovationen aus dem berühmtesten Tal der amerikanischen Wüste bereits im Alltag der meisten Menschen angekommen sind, passieren direkt vor unserer Haustür Entwicklungen, welche ebenso bahnbrechend und zukunftsweisend sind. Die steirische Rechtsanwaltskammer-Präsidentin Gabriele Krenn zu rechtlichen Fragen bei Homeoffice & Co.
Welche Wechselwirkungen sehen Sie zwischen der fortschreitenden Digitalisierung und dem Arbeitsleben?
Gabriele Krenn • Trotz der oft vorhandenen digitalen Möglichkeiten hat niemand ein Recht darauf, statt im Unternehmen des Dienstgebers zu arbeiten von zu Hause aus oder von einem sonst frei gewählten Ort aus zu arbeiten.
Trotzdem wird das Homeoffice mehr und mehr verbreitet. Immer öfter wird in Dienstverträgen vereinbart, dass Arbeitsleistung von zu Hause aus erbracht werden kann. In vielen Bereichen wird diese Entwicklung nur durch die fortschreitende Digitalisierung möglich. Sie ermöglicht die „Anbindung“ des sonst ortsabwesenden Mitarbeiters an das Unternehmen.
Was sind die Motive für diese Entwicklung?
Krenn • Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass der Wunsch nach besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie dabei eine wesentliche Rolle spielt. Der Wunsch nach einem Homeoffice ist Ausdruck des Wunsches nach einer besseren Work-Life-Balance.
Es entfallen Wegzeiten, was vor allem für Dienstnehmer wesentlich ist, die lange Anfahrtszeiten in Kauf nehmen mussten/müssten. Dazu kommt, dass die Arbeit im Homeoffice nur sehr selten mit fixen Arbeitszeiten verbunden ist.
Wäre es nicht naheliegend, dem Dienstnehmer, der im Homeoffice arbeitet, in der Wahl seiner Arbeitszeit völlig freie Hand zu lassen?
Krenn • Jedenfalls abzulehnen wäre die Vereinbarung völlig freier Arbeitszeiten. Ein solches Modell wäre mit unserem Arbeitszeitrecht nicht vereinbar. Ein sinnvoller Mittelweg aber wäre eine Gleitzeitvereinbarung.
Wie kann man den Wunsch des Dienstgebers nach einem Mindestmaß an geregelter Verfügbarkeit und das Recht des Dienstnehmers auf freie Zeiteinteilung gut in Einklang bringen?
Krenn • Häufig bedeutet die Anbindung des Dienstnehmers über digitale Medien eine faktisch ständige Erreichbarkeit. Das wiederum führt dazu, dass durch Telefonate oder E‑Mails die Freizeit unterbrochen wird. Auch wenn es nur um wenige Minuten der Aufmerksamkeit geht, liegt eine Unterbrechung der Freizeit und der Ruhezeit vor. Das Lesen von dienstlichen E‑Mails oder gar das Beantworten ist – auch wenn es noch so wenig Zeit in Anspruch nimmt – Dienstzeit. Das muss auch dem Dienstgeber bewusst sein. Wahrscheinlich sollte man die Verfügbarkeit der digitalen Medien zeitlich sinnvoll beschränken und sie an die vereinbarten Dienstzeiten koppeln.
Worin besteht Ihrer Meinung nach das Risiko einer ständigen Verfügbarkeit in rechtlicher Hinsicht?
Krenn • Es wird in diesen Fällen die Ruhezeit, die gesetzlich vorgegeben ist, unterbrochen. Wenn diese Arbeitszeit nicht erfasst wird oder man sich darüber nicht im Klaren ist, dass es sich dabei um Unterbrechungen der Ruhezeit handelt, drohen spätestens im Konfliktfall mit dem Dienstnehmer Verwaltungsstrafen, weil spätestens dann die Sanktionierung des Arbeitgebers wegen eines Verstoßes gegen das Arbeitszeit- oder das Arbeitsruhegesetz droht.
Viele Arbeitgeber sind sich dieses Risikos nicht bewusst. Es ist daher anzuraten, die auch nur zeitweise Unterbrechung der Freizeit durch den Dienstnehmer genau im Auge zu haben, sich dieses Problems bewusst zu sein und allenfalls strikte Vorgaben über die Einhaltung der Ruhezeit an die Mitarbeiter auszugeben.
Wie kann man hier vorbeugen?
Krenn • Einerseits natürlich durch klare gesetzeskonforme Regelungen mit dem Dienstnehmer. So muss z.B. auch in Gleitzeitvereinbarungen darauf geachtet werden, dass die vorgeschriebenen Ruhezeiten und Höchstarbeitszeiten eingehalten werden.
Andererseits aber natürlich durch korrekte Aufzeichnung der zu Hause geleisteten Arbeit. Es sollte auch ausdrücklich klargestellt werden, dass jede private Unterbrechung der Arbeitszeit Eingang in die Aufzeichnungen findet und es sollte ausdrücklich vereinbart werden, dass diese Aufzeichnungen dem Dienstgeber zeitnah übergeben werden müssen. Wenn eine Erreichbarkeit über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus gewünscht ist, muss das auch vereinbart und vor allem bezahlt werden. Rufbereitschaft ist zu entlohnen. Das wird oft vergessen.
Gibt es abgesehen von Fragen um die Arbeitszeit noch interessante Themen?
Krenn • Ja, absolut. Es gibt eine Reihe von Fragen, die in Vereinbarungen mit dem Dienstnehmer angesprochen werden sollten, z. B. die Frage nach den Arbeitsmitteln, wer installiert sie, wie dürfen sie verwendet werden, wie sind Geheimhaltungsinteressen zu schützen?
Wie hat der Dienstnehmer die Fragen des Datenschutzes zu behandeln?
Krenn • Erfahrungsgemäß haben bei einer Tätigkeit im Homeoffice Angehörige leichter Zugang zu Informationen und Daten unterschiedlichster Art als in einem Büro, das vom Wohnort getrennt ist.
Gibt es außer Regelungen zur Arbeitszeit weitere Schutzbestimmungen, die für den Arbeitnehmer an Tele-Bildschirmarbeitsplätzen im Homeoffice zur Anwendung kommen?
Krenn • Ja, es sind die Arbeitgeber z.B. verpflichtet, Tele-Bildschirmarbeitsplätze ergonomisch zu gestalten. Es sind die dem Stand der Technik und den ergonomischen Anforderungen entsprechenden Bildschirmgeräte-Monitore, Tastaturen etc. zur Verfügung zu stellen.
Die Arbeitgeber müssen allerdings keine Arbeitstische und sonstige Möbel zur Verfügung stellen. Wenn sie es aber tun, müssen sie den erforderlichen ergonomischen Anforderungen entsprechen.
Es gab aber doch auch schon versicherungsrechtliche Fragen.
Krenn • Ja, das stimmt. Da war z.B. vor nicht allzu langer Zeit die Frage nach dem Schutz bei einem Unfall auf dem Weg vom eigentlichen Arbeitsplatz im Homeoffice zur Toilette.
Viele derartige Fragen sind noch offen. Auch die mit dem 3. COVID-19-Gesetz angestrebten Klarstellungen für die Verrichtung lebensnotwendiger Bedürfnisse am Aufenthaltsort und in dessen Nähe sind mit Jahresende befristet, sodass spätestens ab dann die alten Unklarheiten wieder in vollem Umfang bestehen werden.
Foto: Gabriele Krenn, Präsidentin der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer
Fotocredit: Furgler