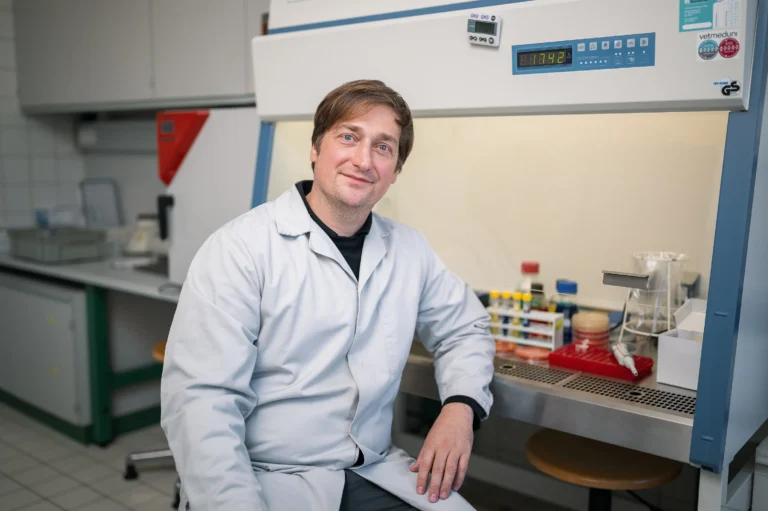ku’ra:ʒə — Courage – kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Mut oder Beherztheit. Allgemein als wertvolle Charaktereigenschaft anerkannt, insbesondere als Zivilcourage gerne gewürdigt, ist Mut doch nicht ohne innere Widersprüche.
Das Problem fängt schon damit an, dass keine klare, abgezirkelte Definition von Mut existiert. Was ist Mut? Was macht einen couragierten Menschen aus? Weitgehend einig ist man sich darüber, dass Mut keine impulsive Handlung darstellt, sondern eine bewusste Entscheidung ist, die nach einem kürzeren oder längeren Überlegen gesetzt wird. Grundlegend dabei: Man muss von der Richtigkeit des eigenen Handelns überzeugt sein. Angst und Mut sind übrigens keine Widersprüche – sie gehen Hand in Hand. Der Mutige tut etwas, obwohl er dabei nicht frei von Angstgefühlen ist. Oder wie es in einem Aphorismus heißt: „Helden sind nicht mutiger als normale Menschen. Sie sind es nur fünf Minuten länger.“
Das Wort Mut stammt von indogermanischen „mo“ ab, das so viel wie sich mühen, nach etwas streben, starken Willens sein bedeutet. Im Germanischen wurde „moda“ oder „modaz“ daraus, was Sinn, Mut, aber auch Zorn heißen kann. Das althochdeutsche „muot“ wiederum kann Sinn ebenso meinen wie Kraft des Denkens oder Wollen. Erst im Hochmittelalter geht die Bedeutung von „muot“ in die heutige Richtung, bringt gleichzeitig die Begriffe Übermut und Hochmut hervor, die mit dem aufkommenden Raubrittertum in Zusammenhang standen. Heute gibt es den Grundbegriff Mut, der allerdings oft in Wortzusammensetzungen näher definiert wird. Sanftmut oder Hochmut, Wagemut oder Wankelmut stehen für völlig unterschiedliche Verhaltensweisen.
Der Begriff Mut hat etwas gelitten, weil er oft mit dem Wort Heldenmut gleichgesetzt wurde, das vor allem im Militärischen eine Rolle spielt. Um besser abgrenzen zu können, wurde die Bezeichnung Zivilcourage geprägt. Wörtlich übersetzt bedeutet sie „Bürgermut“ und meint eine alltägliche Form des mutigen Handelns. Letztlich ist Zivilcourage vor allem ein Nicht-Wegschauen, wenn Personen aber, auch Werte bedroht werden.
Geraten Personen in körperliche Gefahr, äußert sich Zivilcourage meistens spontan. Der Passant, der in einen eiskalten Fluss springt, um ein Kind vor dem Ertrinken zu retten, ist ein Beispiel für diesen spontanen Mut. Deshalb wird Zivilcourage oft mit Hilfe gleichgesetzt, was sie aber nicht unbedingt sein muss. Auch wer in einer Diskussion am Stammtisch moralische und ethische Werte gegenüber der gegenteiligen Meinung der Gruppe verteidigt, handelt im Grunde couragiert. Denn er nimmt mögliche Nachteile in Kauf, um soziale und humane Werte zu wahren. Couragierte Menschen achten nicht darauf, was alle anderen tun, sondern darauf, was sie selbst für richtig und wichtig halten.
Eine der schönsten – und wahrscheinlich auch klügsten – Beiträge zum Thema ist der legendäre Hollywood-Klassiker „Der Zauberer von Oz“ aus dem Jahr 1939. Darin helfen drei seltsame Gesellen der kleinen Dorothy (gespielt von Judy Garland) dabei, aus dem Zauberland, in das ein Tornado sie verschlagen hat, zurück nach Kansas zu gelangen. Es sind die hirnlose Vogelscheuche, die sich Verstand wünscht, der seelenlose Blechmann, der verzweifelt ein Herz möchte, und der feige Löwe, der endlich mutig sein will. Im Laufe der Handlung erkennt der Zuschauer, dass die Vogelscheuche in Wahrheit sehr klug agiert, der Blechmann ein extrem mitfühlendes Wesen ist und der Löwe äußerst couragiert handelt. Vom großen Zauberer erhält die Vogelscheuche ein Universitätsdiplom, der Blechmann eine Uhr in Herzform und der Löwe einen Orden, was die drei Protagonisten davon überzeugt, dass sie die von ihnen ersehnten Eigenschaften besitzen. Sie haben den Beweis erbracht, dass Mut, Herz und Verstand zusammenwirken müssen, um Erfolg zu haben.
Um auf den militärischen Mut, den Heldenmut, zurückzukommen, so ist dieser in Geschichte und Mythen umfassend dokumentiert. Es gibt Tausende von Beispielen wie die legendären 300, jene spartanischen Krieger, die sich im Jahr 480 vor Christus in einem Engpass, den Thermopylen, einer eine Million Mann starken persischen Übermacht entgegenstellten. Wohl wissend, dass sie den Kampf weder überleben und schon gar nicht gewinnen konnten, ihre Tapferkeit aber die rechtzeitige Evakuierung Athens und damit letztlich den Sieg Griechenlands über die persischen Invasoren ermöglichen werde.
Das Ereignis zeigt übrigens schön, wie sehr Mut glorifiziert wurde und immer noch wird. Denn die historische Wahrheit ist weit weniger eindrucksvoll. An den Thermopylen, damals ein stellenweise nur 15 Meter breiter Streifen zwischen Berghang und Meer, standen rund 6000 Griechen zwischen 50.000 und 250.000 Persern und deren Hilfstruppen gegenüber. Immer noch ein gewaltiger Unterschied, aber natürlich bei Weitem nicht so spektakulär wie in der Legende.
Gerade im Zusammenhang mit dem Militärischen zeigt sich manchmal ein wenig beachteter Aspekt des Mutes, nämlich der Mut, etwas nicht zu tun. Gemeint ist die Befolgung von Befehlen, die den simpelsten ethischen Grundlagen zuwiderlaufen. Sattsam bekannte Beispiele sind der Befehl, die Zivilbevölkerung als Rache für Partisanenangriffe zu massakrieren oder angesichts der drohenden Niederlage nur verbrannte Erde zu hinterlassen.
Beim Mut, solchen irrsinnigen Befehlen nicht zu gehorchen, schließt sich der Kreis zur Zivilcourage. Auch dort kann es Mut erfordern, nicht mitzumachen, etwa wenn es darum geht, einen Mitschüler zu mobben. Wer mit den Wölfen heult, gehört zur Gruppe. Sich am Mobbing nicht zu beteiligen, kann den Ausschluss bedeuten, selbst bloße Passivität erfordert also manchmal Courage.
Wie sieht es aber mit Mut im Wirtschaftsleben aus? Dort spielt er eine nur untergeordnete Rolle – glaubt man zumindest diversen Rankings, in denen die wichtigsten Eigenschaften für Firmengründer und ‑chefs aufgelistet werden. Eigenmotivation, Beharrlichkeit und Selbstvertrauen stehen da weit oben. Risikobereitschaft und Wissbegierde sowie Durchsetzungsvermögen sind ebenfalls in den meisten Ranglisten zu finden.
Es gibt sogar Menschen aus der Praxis, die bei einer Unternehmensgründung Mut für kontraproduktiv halten. Wer Courage mit einer Firmengründung in Verbindung bringe, schätze das im Grunde als waghalsiges Unterfangen ein, lautet die Argumentation. Und aus falsch verstandenem Mut halte man in der Folge auch dann noch an der Geschäftsidee fest, wenn sich diese als Irrweg herausgestellt habe.
Dem widersprechen die meisten Gründerzentren, die Jungunternehmern im Gegenteil gezielt Mut machen wollen. Und Banken, die sich angehende Start-ups sehr genau ansehen, bevor sie bei der Finanzierung mitspielen, betonen immer wieder, dass sich Courage für den einzelnen Unternehmer in der Regel durchaus bezahlt macht. Es gibt sogar Auszeichnungen für besonders mutige Unternehmer. „Es braucht Mut, seine Visionen und Träume zu realisieren und ein Unternehmen zu gründen. Es braucht Mut, auch in stürmischen Zeiten den eigenen Idealen und Überzeugungen treu zu bleiben. Und es braucht Mut, sein Unternehmen auf Wachstumskurs zu bringen“, heißt es etwa in der Ausschreibung für den begehrten Unternehmerpreis Entrepeneur Of The Year.
Vielleicht hilft bei der Einordnung der sich widersprechenden Ansichten – die ja nicht nur in der Welt des Business existieren – ein Mythos, der sich um das Thema Mut rankt: Nur wer tollkühne Taten vollbringt, ist wahrhaft mutig. Nicht viel könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Courage bedeutet nämlich genau nicht, uneinschätzbare Risiken einzugehen – wobei die Betonung auf uneinschätzbar liegt. Mut hat immer etwas mit Vernunft zu tun und Tollkühnheit schließt diese aus. Courage heißt, eine emotionale Barriere zu überwinden, etwas zu tun, das nicht angenehm, aber notwendig ist.
Kalkulierte Risiken sind hingegen notwendig, nicht nur im Business. Allerdings mag der menschliche Geist sie nicht. Psychologen wissen, dass wir die Gefahr des Scheiterns deutlich ernster nehmen als einen möglichen Gewinn. Mögliche Gefahren werden ungefähr doppelt so hoch bewertet wie Gewinnchancen. Courage macht es möglich, diese Risikoaversion zu überwinden.
Aber wie wird man mutig? Einer der wichtigsten Schritte ist es Experten zufolge, den Anspruch aufzugeben, fehlerfrei zu handeln. Dummerweise werden wir alle bereits in der Schule darauf programmiert, Fehler zu vermeiden. Sie werden negativ bewertet, das „Richtige“ hingegen wird belohnt. Leider ist es illusorisch, davon auszugehen, dass man niemals einen Fehler begeht.
Clevere Unternehmen haben das schon vor längerer Zeit erkannt. Sie verwenden das „fail-forward-system“, um erfolgreiche Produkte zu entwickeln. Zuerst wird ein gerade eben funktionsfähiges Produkt hergestellt, Unvollkommenheiten werden dabei nicht ausgebügelt. Wird es gekauft, wird es jede Menge Kritik von Kunden geben. Aber anhand dieser erkennt der Hersteller, in welche Richtung er nachbessern muss. Ein typisches Beispiel ist die berühmte „Banana-Software, die beim Kunden reift“. Sicher ärgern sich die Early Adopter, klar muss der Hersteller etwas aushalten, wenn es Kritik hagelt. Am Ende allerdings profitieren beide: der Hersteller, weil er sich teure Fehlentwicklungen spart, der Kunde, weil er eine Software in Händen hält, die das kann, was er wirklich braucht.
Ein Aspekt, den man beim Thema Mut nicht unterschätzen sollte, ist die Ermutigung. Entsprechende Reden gibt es vor allem in der Militärgeschichte zuhauf, Napoleons Ansprache vor den Pyramiden sei hier erwähnt oder Churchills legendäre Radioreden während des Zweiten Weltkriegs, die vor allem der Zivilbevölkerung Zuversicht vermitteln sollten. Weniger martialisch, aber dafür umso wichtiger ist die Ermutigung von Mitarbeitern, sie ist aus dem modernen Verständnis von Motivation nicht wegzudenken.
Leider wird Ermutigung – nicht nur im Wirtschaftsleben, aber besonders dort – oft mit Lob verwechselt. So wichtig Anerkennung ist, sie bezieht sich auf bereits Geleistetes. Ermutigung hingegen zielt in die Zukunft, und die können wir noch ändern.
Illustration: Gernot Reiter