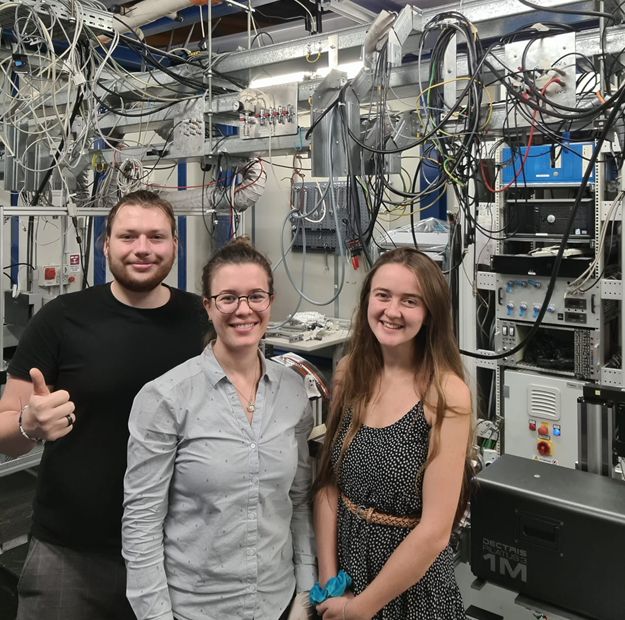Diese bahnbrechende Erkenntnis ebnet den Weg zu leistungsfähigeren Energiespeichern – und könnte sogar helfen, Ewigkeitschemikalien (PFAS) aus Wasser zu entfernen.
Das verwendete Elektrodenmaterial bestand aus der Materialklasse der metallorganischen Gerüstverbindungen (MOFs), deren Entwicklung im heurigen Jahr mit dem Chemienobelpreis ausgezeichnet wurde. Die Studie erschien in der renommierten Fachzeitschrift Nature Communications.
Energiespeicher der Zukunft im Detail verstehen
Die Energiewende braucht Speichertechnologien, die schnell, effizient, nachhaltig und langlebig sind. Superkondensatoren erfüllen viele dieser Anforderungen:
-
Sie laden in Sekunden,
-
überstehen Millionen Ladezyklen,
-
und kommen ohne seltene Rohstoffe aus.
Ihr Innenleben ist jedoch ein komplexes Puzzle, das bislang nur teilweise verstanden wurde. Forschende aus Leoben haben nun ein entscheidendes Teil dieses Puzzles gefunden.
Die Arbeit entstand im Rahmen der Dissertation von Malina Seyffertitz am Lehrstuhl für Physik der Montanuniversität Leoben, in Kooperation mit der University of Cambridge.
„Wir wollten verstehen, was im Inneren eines Superkondensators während des Ladens und Entladens passiert – und wie sich die Ionen in den Nanoporen der Elektroden verhalten“, erklärt Univ.-Prof. Oskar Paris.
Klarer Blick durch Synchrotronstrahlung und Modellmaterial
Um die Bewegung der Ionen „operando“ – also in Echtzeit – zu beobachten, nutzte das Forschungsteam hochbrillante Röntgenstrahlung an drei europäischen Großforschungsanlagen in Triest, Grenoble und Hamburg.
Die in Leoben entwickelte experimentelle Plattform ermöglicht künftig auch Untersuchungen anderer elektrochemischer Systeme.
Als Modellmaterial kamen MOFs (Metal-Organic Frameworks) zum Einsatz – jene Materialklasse, die 2024 den Chemienobelpreis erhielt. Die geordnete Struktur dieser MOFs erleichtert die Datenanalyse und erlaubt präzise Rückschlüsse auf die Mechanismen der Energiespeicherung.
Zentrale Entdeckung: Fest gebundene Anionen
Dank der Kombination aus maßgeschneidertem Material und modernster Messtechnik konnte der Lade- und Entladevorgang auf atomarer Ebene in Echtzeit verfolgt werden.
Dabei zeigte sich:
-
Fluorhaltige Anionen binden sich fest an stickstoffhaltige Gruppen in den MOF-Poren.
-
Diese gebundenen Teilchen bleiben unbeweglich, selbst bei wechselnder Spannung.
-
Der Ladungsausgleich erfolgt daher hauptsächlich durch mobile Kationen.
Damit konnte erstmals erklärt werden, warum Superkondensatoren häufig kationen-dominant arbeiten – und wie sich der Ladungsmechanismus gezielt steuern lässt.
Vom Modellmaterial zur praktischen Anwendung
Dieses neue Verständnis der Ionenbewegung liefert eine wichtige Grundlage, um Superkondensatoren gezielter und effizienter zu entwickeln.
Das Leobener Forschungsteam arbeitet bereits daran, die beobachteten Mechanismen auf nachhaltige Kohlenstoffmaterialien zu übertragen.
Darüber hinaus eröffnen die entdeckten Wechselwirkungen neue Perspektiven für Umweltanwendungen – etwa bei der Entfernung langlebiger Schadstoffe wie PFAS („Ewigkeitschemikalien“) aus Wasser.
Synchrotronstrahlung als Schlüssel zu besseren Energiespeichern
Die Forschung der Montanuniversität Leoben zeigt, wie präzise physikalische Methoden wie die Synchrotronstrahlung helfen können, das Innenleben moderner Energiespeicher zu entschlüsseln.
Die gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur ein Meilenstein für die Materialwissenschaft, sondern auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft.