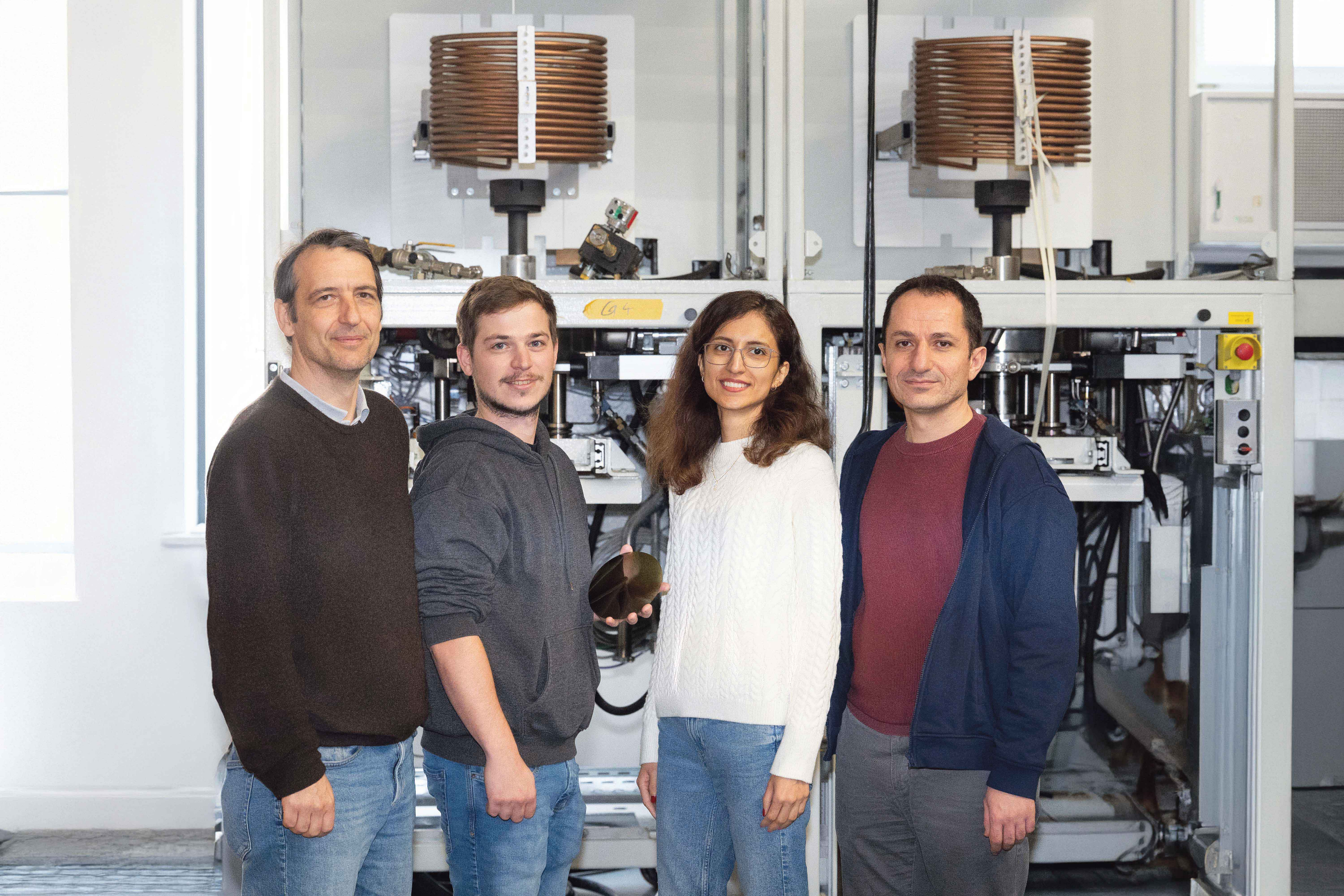Lorenz Romaner versteht sich aufs Kuchenbacken. Allerdings nicht im herkömmlichen Sinn. Der Werkstoffwissenschaftler an der Montanuniversität Leoben beschäftigt sich nicht mit Mehl, Ei und Zucker, sondern mit Siliziumcarbid – einem Halbleitermaterial, das klassische Siliziumchips eines Tages in vielen Anwendungen ablösen könnte.
Kristallzucht bei 2200 Grad
Das Herstellen der Kristalle ähnelt eben dem Backen von Guglhupf und Co.: „Siliziumcarbid-Pulver wird in einen Ofen geschoben. Dessen Inneres ist mit rund 2200 Grad freilich deutlich heißer als das, was man so in der Küche hat“, schildert der Wissenschaftler. „An einer Stelle im Ofen, die geringfügig kühler ist, wächst dann ein Kristall, der bis zu drei Zentimeter hoch werden kann. Ist es so weit, wird der Ofen ausgeschaltet und der „Kuchen“, sprich: der Kristall, herausgenommen.“ Die Backzeit ist allerdings lang: Bis der Kristall so richtig „aufgegangen“ ist, können bis zu zwei Wochen vergehen. Für einen einzigen Kristall ist das viel Aufwand, andererseits kann man ein Exemplar für die Produktion sehr vieler Bauteile verwenden.
Die digitale Backstube
Romaner leitet auch ein „Christian-Doppler-Labor für computergestütztes Design von Kristallzuchtprozessen“. Der Forscher gibt einen Vorgeschmack darauf, was er und sein Team herauszufinden hoffen: „Wir wollen eruieren, wie die Vorgänge im Ofen zu optimieren sind, sodass man einen perfekten Kristall ohne Defekte züchten kann. Würde man eine Schaltung mit einem defekten Kristall bauen, würde sie nicht oder nur sehr ineffizient funktionieren.“ Romaner und sein Team machen das mit Computern und künstlicher Intelligenz.
„Wir simulieren den Herstellungsprozess von Kristallen und beschreiben ihn virtuell, bis hin zu atomaren Längenskalen. Dafür verwenden wir physikbasierte Ansätze, also Gleichungen, sowie datengetriebene Methoden, für die wir auf maschinelles Lernen zurückgreifen.“
Wenn es gelingt, das Wachstum der Kristalle auf diese Weise zu modellieren, lassen sich sowohl der Zuchtprozess als auch der Ofen selbst optimieren. Und man könnte den Ofen in Echtzeit steuern bzw. regulieren, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Fazit
Warum sich die Forscher die Arbeit überhaupt antun? Schließlich wird schon gefühlt seit es elektrische Schaltungen gibt, Silizium verwendet, das weniger aufwendig zu gewinnen und außerdem wesentlich billiger ist als Siliziumcarbid? „Für Leistungselektronik eignet sich Siliziumcarbid einfach besser“, erklärt Romaner. Aufgrund der höheren Wärmeleitfähigkeit von Siliziumcarbid im Vergleich zu Silizium kann die Wärme, die bei allen elektrischen Vorgängen ensteht, leichter abgeleitet werden.
Vor allem aber sind höhere Spannungen und höhere Schaltfrequenzen möglich. „Damit verringern sich auch die Leistungsverluste“, so Romaner. Anwendungen sind unter anderem die Ansteuerung des Antriebs von Elektrofahrzeugen oder die Wechselrichter in Photovoltaikanlagen. Da soll noch einer sagen, dass die Forschung in Österreich nichts gebacken kriegt …