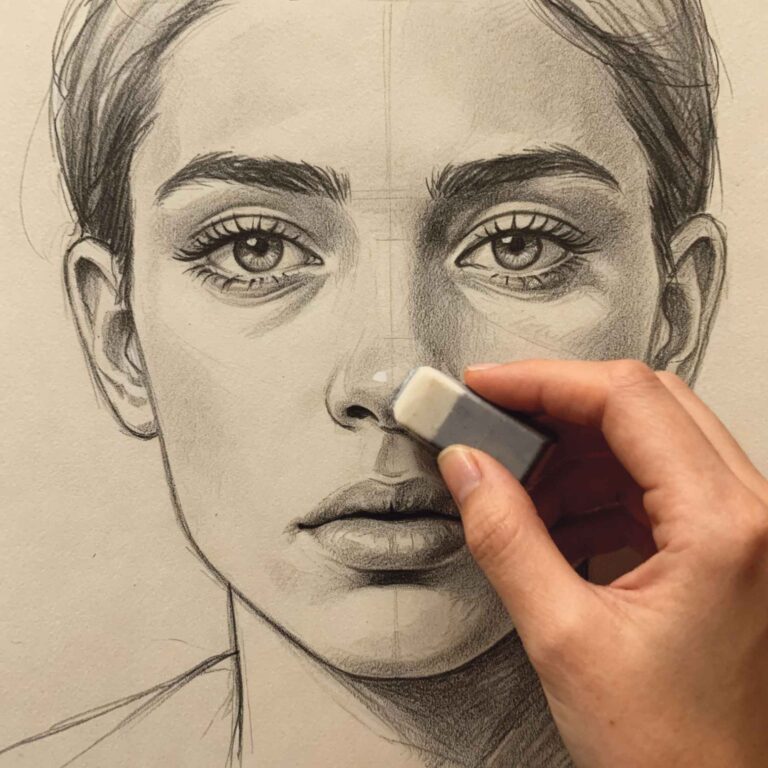Unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Lorenz Romaner vom Lehrstuhl für Metallkunde (Department Werkstoffwissenschaft) wird im neuen Christian Doppler Labor in Leoben an Computergestütztem Design von Kristallzuchtprozessen geforscht.
Die Forschungseinheit ist Teil der Christian Doppler Forschungsgesellschaft, die Wissenschaft und Wirtschaft vereint, um anwendungsorientierte Grundlagenforschung auf hohem Niveau zu betreiben. Finanziert werden die Labore von den Unternehmen sowie von öffentlicher Hand. Der wichtigste öffentliche Fördergeber ist das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft.
Arbeits- und Wirtschaftsministerium fördert Forschung an neuartigen Modellierungsmethoden
„Elektromobilität kann einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Die Technologie hat sich in den vergangenen Jahren schnell weiterentwickelt und wird zukünftig noch mehr Potenzial bieten. Das Christian Doppler Labor forscht an Bauelementen, die möglichst effizient und verlustarm arbeiten. Damit kann die Herstellung der Elemente in Zukunft einfacher und kostengünstiger werden. Die hier erarbeiteten Grundlagen werden zur Effizienz der zukünftigen Elektromobilität beitragen und gleichzeitig auch Österreichs Halbleiterindustrie stärken”, betont Arbeits- und Wirtschaftsminister Prof. Dr. Martin Kocher.
Neues Labor in Leoben unterstützt die Halbleiterindustrie
Das Forschungsteam will neuartige Modellierungsmethoden für die virtuelle Beschreibung von Kristallwachstumsprozessen in der Halbleiterindustrie erarbeiten. Im Zentrum der Arbeit steht das Siliziumkarbid (kurz: SiC), eine chemischen Verbindung aus Silizium und Kohlenstoff. „Der Vorteil des Siliziumkarbids gegenüber dem reinen Silizium besteht darin, dass es bei höheren Spannungen und Temperaturen betrieben werden kann. Gleichzeitig die Schaltfrequenzen erhöht. Auch die Leistungsverluste sinken merklich.“, erklärt Laborleiter Univ.-Prof. Dr. Lorenz Romaner.
Die Schwierigkeit besteht nun darin, diese SiC-Kristalle als Serienprodukt herzustellen. Die zentrale Aufgabe im Labor in Leoben ist, Modellierungsmethoden zu finden, die in der Lage sind, diese Kristallwachstumsprozesse möglichst präzise vorherzusagen.
Methodenmix aus physikbasierten und datengetriebenen Modellen
Einerseits können hier physikbasierte Modelle grundlegende Eigenschaften wie beispielsweise Kristallstrukturen und Kristalldefekte vorhersagen oder Temperaturverläufe und Massentransport im Ofen berechnen. Andererseits können datengetriebene Methoden verwendet werden, um Zusammenhänge zwischen Qualitätsparametern des Kristalls und experimentellen Daten, die laufend in der Herstellung gesammelt werden, herzustellen. Vielversprechend ist auch die Kombination beider Ansätze. Mit Wissen aus physikalischen Modellen können so beispielsweise physikalische Methoden beschleunigt oder fehlende Information in den Daten vervollständigt werden.
„Im neuen Christian Doppler Labor in Leoben versuchen wir, sogenannte hybride Modelle zu entwickeln. Diese sollen physikbasierte und datengetriebene Modelle vereinigen. Damit wollen wir erreichen, die Wachstumsprozesse von diesen SiC-Kristallen möglichst exakt vorhersagen zu können“, ergänzt Romaner.
Als Firmenpartner fungiert die EEMCO GmbH, die auf die Produktion von SiC-Kristallen spezialisiert ist.