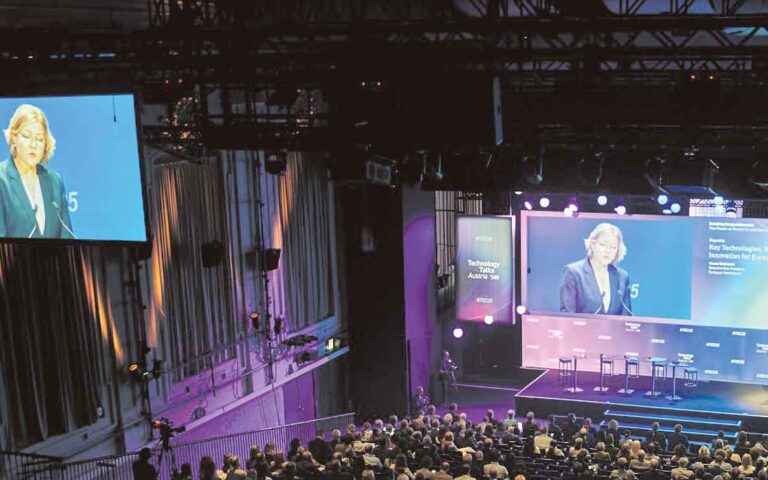Mit dem 3D-Druck von Bauteilen aus Keramik befasst sich die Montanuniversität Leoben. Die Anwendungsmöglichkeiten für die gedruckten Teile sind die Medizin – etwa im Bereich von Knochenimplantaten –, aber auch die Mikroelektronik. Ein entsprechender Drucker steht in Leoben seit dem vergangenen Sommer zur Verfügung.
Die in dem neuen 3D-Drucker gefertigten Bauteile haben gemeinsam, dass sie eine komplexe Geometrie besitzen und/oder aus unterschiedlichen Materialien bestehen, die sich nur schlecht miteinander verarbeiten lassen. „Verbundstoffe bzw. Multimaterialien aus Keramik, Metall und Polymeren stellen eine große Herausforderung dar“, schildert Raúl Bermejo, Leiter des Lehrstuhls für Struktur- und Funktionskeramik an der Montanuniversität. „Erst die Entwicklung von sogenannten additiven Fertigungsverfahren ermöglicht die Verarbeitung von unterschiedlichen Werkstoffkombinationen zur Herstellung komplexer Bauteile.“
Bermejo und sein Team arbeiten mit der Wiener Firma Lithoz GmbH zusammen, welche mit ihren 3D-Druckern, Materialien und Lösungen für die industrielle Produktion von Hochleistungs- und bioresorbierbaren Keramiken Weltmarkt- und Technologieführer ist. Ein solcher 3D-Drucker von Lithoz steht an der Montanuniversität.
Die Forschungsgruppe unter Bermejo forscht an neuen Zusammensetzungen des sogenannten Schlickers, jenes puddingähnlichen Materials, welches in den Drucker gefüllt wird und aus dem dann die Bauteile entstehen. „Bei diesem Schlicker handelt es sich um eine Mischung aus Polymeren und Keramikpulver. Je kleiner die Keramikteilchen im Schlicker sind, desto präziser kann gedruckt werden. Die Kunst ist es, immer kleinere Partikel einzusetzen und diese zu homogenen Schlickern zu verarbeiten.“ Während des Druckprozesses werden Schichten von Schlicker aufgetragen und gezielt mit Licht bestrahlt, welches das Polymer im Schlicker zum Aushärten bringt. Durch das Aufeinanderschichten kann Schicht für Schicht ein dreidimensionales Bauteil erzeugt werden. „Zum Schluss muss das Bauteil von dem Polymer befreit und die Keramik bei etwa 1.500 Grad Celsius gebrannt werden“, erzählt der Wissenschafter.
Der Clou an dem Vorgang ist, dass jede Schicht theoretisch aus einem anderen Material gedruckt werden kann. Die eingesetzten Materialien haben verschiedene Eigenschaften, die richtige Kombination kann man sich für die jeweilige Aufgabe zunutze machen.
„Wir versuchen oft, die Natur nachzuahmen“, sagt Bermejo. „In einem Zahn gibt es auch unterschiedliche Schichten, manche sehr hart, andere weicher. Nur hart bedeutet meist auch spröde und das soll nicht sein.“ Die bioinspirierten Konzepte aus dem 3D-Drucker weisen eine ähnliche innere Architektur wie zum Beispiel Knochen oder eben Zähne auf. Die komplexe innere Geometrie, die das Druckverfahren ermöglicht, sorgt dafür, dass die Werkstücke viel höheren Belastungen standhalten, als es bei nur einem Material der Fall wäre.
Die Anwendungsgebiete der 3D-Verbundkeramik sind zum Teil auch im biomedizinischen Bereich. Zahnkronen und ‑brücken sind Beispiele dafür. „Man kann einen dreidimensionalen Scan des natürlichen Zahns machen und dann eine Eins-zu-eins-Kopie des Originals aus Keramik mittels 3D-Druck herstellen. Diese hat dann exakt die Eigenschaften des natürlichen Zahns“, ist der Lehrstuhlleiter stolz. Die Anwendung befinde sich allerdings noch im Versuchsstadium. Bermejo: „Wir sind gerade in der Proof-of-Concept-Phase, haben aber schon sehr hohe Festigkeiten erreicht.“
Eine weitere Möglichkeit der Nutzung des 3D-Druckers ist, Hüftprothesen zu verbessern. „Die bestehen ja aus einem Titanschaft und einem Keramikkopf, der den Gelenkskopf des Oberschenkelknochens ersetzt“, weiß Bermejo. Weil bei der Implantation der Prothese der Titanschaft in den verbleibenden Knochen eingehämmert werden muss, bekommt der Keramikkopf manchmal kleine Risse die zu einer schnelleren Abnutzung führen. „Genau diese Defekte werden durch unsere Verbundkeramik verhindert, da diese deutlich weniger empfindlich gegen stumpfe Schläge ist.“
Eine vollkommen andere Anwendung des 3D-Druckers ist die Verbindung von keramischen Werkstoffen mit Metallen, welche für die Mikroelektronik sehr interessant ist. „Bei Teilen, die eine bestimmte Geometrie erfordern und die man nur in geringen Stückzahlen braucht, ist der Druck als Herstellungsvariante interessant“, sagt der Wissenschafter. Eine Anwendung sei in Brennstoffzellen, um die Leistung zu erhöhen. Dafür müsse die Keramik einerseits sehr dicht sein, andererseits aber Ionen leiten. Eine andere wäre die Raumfahrt, wo man so Hitzeschilde für den Wiedereintritt von Raumfahrzeugen in die Erdatmosphäre produzieren könnte. „Mit dieser äußerst vielversprechenden Technologie stecken wir aber noch in der Frühphase“, schränkt Bermejo ein.
Neben der vorwiegend anwendungsorientierten Entwicklung beschäftigt sich die Montanuniversität Leoben auch mit Grundlagenforschung im Bereich Keramik. „Über das EU-Projekt CeraText leisten wir einen Beitrag, um Keramik in ihrer Mikrostruktur zu verstehen bzw. einzustellen“, erzählt Bermejo. „Dabei entwickeln wir Modelle, die zeigen sollen, wie Keramik auf Belastungen reagiert, seien sie thermischer oder mechanischer Natur. Wie entstehen Risse im Werkstoff auf Meso,- Mikro- und gar Nanoebene und wie breiten sie sich aus? Das alles wird zur Verbesserung der Eigenschaften von Keramiken führen.“ Zwei Millionen Euro in fünf Jahren stehen für das Projekt aus EU-Mitteln zur Verfügung. Forschungspartner von Bermejo ist dabei die US-amerikanische Pennsylvania State University, an der der Materialexperte ein Jahr lang tätig war.
Besonders stolz ist Bermejo auf sein tolles Team. „Es sind alles junge, engagierte Kollegen und Studenten, die meine Leidenschaft für Neues und die Erforschung von diesem teilen.“ Eine große Motivation sei es, dass Leoben zwar eine im internationalen Vergleich rein auf die Größe bezogen kleine Universität ist, jedoch die beeindruckenden Forschungsergebnisse international sehr angesehen sind. Durch die kompakte Größe ist die Beziehung zwischen Lehrenden und Studierenden intensiver und letztere werden viel stärker in die Forschungstätigkeit eingebunden.“
Kontakt:
Montanuniversität Leoben
www.unileoben.ac.at
Fotocredit: Lithoz GmbH
“SCIENCE” WIRD MIT FINANZIELLER UNTERSTÜTZUNG IN VÖLLIGER UNABHÄNGIGKEIT UNTER DER REDAKTIONELLEN LEITUNG VON ANDREAS KOLB GESTALTET.