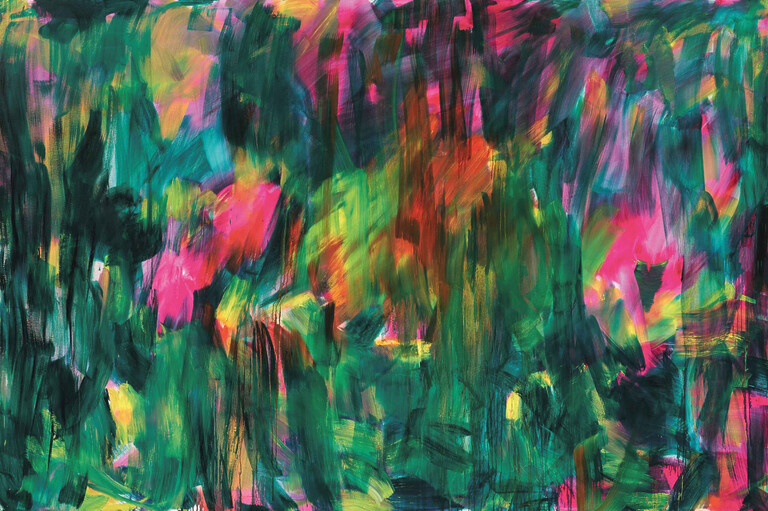Die digitale Zukunft ist im vollen Gange. Doch sind auch die Klassenzimmer dafür bereit?
Unter dem Titel Digitalisierungsstrategie 4.0 sollen digitale Inhalte einerseits breiter, als auch über einen längeren Zeitraum vermittelt werden. Technisches Grundverständnis soll bereits spielerisch in der Volksschule beginnen, in weiterführenden Schulen folgen zwei bis vier verbindliche Wochenstunden mit einem Fokus auf die gesellschaftlichen Aspekte der Digitalisierung, Medienkompetenz und etwa das Verstehen von Betriebssystemen.
Doch wie bestimmt man, wer die notwendige Kompetenz hat, solche Inhalte zu lehren? Wie bestimmt man heute Fähigkeiten, die erst in 20 oder 30 Jahren relevant sein werden? Und wie erkennt man Trends, die sich in nur wenigen Jahren so stark verändern können, dass Technologien von vor 10 oder 20 Jahren – man denke an Speichermedien wie CDs oder Disketten – heute kaum noch relevant sind?
Digitalisierung 4.0
Bei einer Podiumsdiskussion am Bildungsforum Zukunft, das Ende Februar im Wiener Museumsquartier stattfand, erwähnte Bildungsminister Heinz Faßmann, dass man die Kompetenzen der Zukunft noch nicht genau kenne: „Studien können dabei helfen, aber in der Zwischenzeit müssen wir uns auf allgemeine Termini wie Kreativität, Teamfähigkeit oder Übersetzungsfähigkeit berufen.“ Auch der Begriff des handlungsorientierten Unterrichts geistert in dieser Diskussion immer wieder durch den Raum. Schüler sollten in das Zentrum des Lernprozesses rücken, heißt es von Seiten der Experten. Das sehen auch die Schüler und Schülerinnen so.
„Wenn es um uns geht, sollte man uns auch fragen“, sagt Katharina Bartosch, Schülerin und Mitglied von YEP, einem außerschulischen Lernort, der Jugendliche via Workshops und Coaching dabei begleitet, sich in den gesellschaftlichen Dialog einzubringen. Fehlt es den Experten noch an Konkretisierung der Konzepte, kursieren dennoch schon Ansätze und Technologien.
IWB (Interactive white board), BYOD (bring your own device) und AI (artificial intelligence) – assisted learning – so heißen einige der Instrumente für die Schule der Zukunft. Laut eines Reports des Artificial Intelligence Market im US-amerikanischen Bildungssektor wird erwartet, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz auf US-amerikanischen Schulen zwischen den Jahren 2017 bis 2021 um knapp 50 Prozent steigen wird. Firmen wie Content Technologies und Carnegie Learning arbeiten an intelligenten Systemen, die Lehrern in Prüfungssituationen und beim Feedback an die Schüler unterstützen können. Mit einer interaktiven Tafel wie dem IWB können Sachen auf interaktive Weise und in Kooperation notiert werden, Notizen direkt über Videos gelegt werden und all das kann dann auf verschiedenen Geräten geteilt werden.
Dünger für die Bildung
Am Institut für partizipative Sozialforschung hat Maria Angerer im Auftrag der Bildungsinitiative Bildünger eine Studie über Bildungsgestalter in Österreich gemacht. Dazu gehören Lehrer und Lehrerinnen, aber auch private Organisationen und Projekte. Die Herausforderungen? 39 Prozent geben an zu wenig Zeit, weitere 39 zu wenig Geld und 38 Prozent zu wenig rechtlichen Spielraum zu haben. Nur fünf Prozent gaben an, dass es einen Widerstand vonseiten der Schüler gab. Erfreuliche Nachrichten. Doch was brauchen diese Leute dann? Angerer schlägt vor, Unzufriedene und Zufriedene in den Austausch zu bringen. Dazu gehören auch Lehrerpersonen, denen schlichtweg Kontakte zu denen fehlen, die etwas verändern wollen und können.
Das Problem mit der fehlenden Zeit ist auch eines des neuen Lehrplans der Digitalisierungsstrategie 4.0. Nicht die Inhalte und Möglichkeiten, sondern die Art und Weise, in der diese vermittelt werden sollen, stoßen auf Hürden. In der neuen Lehrerausbildung gebe es zwar ein Portfolio „Digitale Kompetenzen“, jedoch ist dieses für Lehrer und Lehrerinnen nach wie vor eine Art freiwillige Fort- und Weiterbildung, heißt es in einem zusammenfassenden Vortrag des Bildungswissenschaftlers Manuel Reisinger. Wie also Raum für diese Entwicklungen schaffen? Dazu kommt, dass das Thema digitale Geräte bei vielen Lehrpersonen noch auf Abneigung stößt. In einer aktuellen Studie des IT-Branchenverbands Bitkom sprach sich kaum einer der 500 befragten Lehrenden für die Verwendung der mitgebrachten Smartphones aus, 90 Prozent sind sogar explizit dagegen. Dagegen steht aber das scheinbare Engagement der Schüler: Der Aussage „Die Schüler sind durch digitale Medien motivierter“ stimmen 88 Prozent der Lehrenden zu. Braucht es eine inhärente Veränderung des Systems, das digitale Lehre nicht als separates Feld sieht?
An der Pädagogischen Hochschule Wien wird ein solcher innovativer Ansatz getestet. In Kooperation zwischen den Bundesministerien für Familie und Jugend und dem Bundesministerium für Bildung wurde beschlossen, das erste Future Classroom Lab (FCL) einzurichten. In diesem geht es darum, ein Klassenzimmer der Zukunft zu gestalten: Lerngruppen behandeln eine Forschungsfrage im Rahmen eines Stationenbetriebs in fünf Lernphasen. In deren Verlauf werden Technologien zielführend und professionell eingesetzt. Die zusätzliche Zeit im Klassenraum kommt dadurch zustande, dass die Lehrenden Videos vorbereiten, die sich die Schüler und Schülerinnen zu Hause ansehen können. Der Input passiert im eigenen Tempo, im Unterricht wird die Zeit zum Üben verwendet und die Lehrkraft wird zum Coach – ein sogenanntes Flipped Classroom, also umgedrehtes Klassenzimmer.
Die Schule in den Wolken
Einer, der sich schon seit Jahren mit ähnlichen Ideen auseinandersetzt, ist Sugata Mitra. Der indische Bildungswissenschaftler und Informatiker zeigte mit seinem Hole-in-the-wall-Experimenten, dass sich SchülerInnen ein digitales Grundverständnis selbstorganisiert und eigenhändig beibringen können. Dafür stellte er zunächst einen Computer mit Internetzugang in eine Maueröffnung eines Slums in Neu-Delhi. Die Kinder, die zuvor noch nie mit Technik geschweige denn Computern in Kontakt gekommen waren, lernten ohne Hilfe von Tutoren, Informatikern oder Lehrern innerhalb von wenigen Wochen, wie man das Internet verwendet. „Wenn man einen sicheren öffentlichen Platz hat, an dem Leute sehen können, was passiert, funktioniert das immer. Voraussetzung ist, dass die Kinder in Gruppen arbeiten“, sagt er beim Zukunftsforum Bildung.
Nach dem Start 1999 wiederholte Mitra das Experiment an vielen Orten weltweit – jedes Mal erfolgreich –, bis es schließlich Eingang in britische Klassenzimmer fand. Das Experiment entwickelte sich in ein Projekt, das Projekt in ein Konzept. Heute gibt es SOLES – self organized learning environments –, die in Kombination mit technischen Hilfsmitteln auch „schools in the cloud“ genannt werden, auf der ganzen Welt. In Klassenzimmern kann das so aussehen: Eine Person stellt eine Frage. Den Kindern wird daraufhin in Gruppen ein Gerät mit Internetzugang zur Verfügung gestellt, um diese Frage zu lösen. Die Antworten werden daraufhin besprochen. „Kinder können auf diese Weise wirklich alles lernen“, so Mitra. Sollte seine These stimmen, dann schreit diese Entwicklung geradezu nach einer Umstrukturierung der Klassenräume und unserer Ideen von Wissensvermittlung.
Mitra schlägt vor, digitale Fähigkeiten nicht als separates Fach zu sehen, sondern in den generellen Tagesablauf aller Fächer zu integrieren. Die Fähigkeiten comprehension, communication und computing, also Verständnis, Kommunikation und EDV würden Lesen, Schreiben und Rechnen ersetzen. Zusätzliche Fächer wären schlicht „Das Internet“ (und wie es funktioniert) sowie „komplexe dynamische Systeme“, deren Verständnis er die Physik der Zukunft nennt. Dazu gehört etwa auch das Phänomen, das er selbst beschrieben hatte: die Selbstorganisation von Gruppen.
Mut zur Veränderung
Stoßen die Schüler dabei auf kontroverse Informationen, gäbe es notwendige, automatische Mechanismen: „Ich habe oft erlebt, dass sich die Schüler selbst korrigieren“, so Mitra. Stößt eine Gruppe auf ein seltsames Ergebnis, wird es Einwände von anderen Mitschülern geben. So ist es auch möglich, die Rolle der Lehrer der Zukunft zu definieren. Sie wären diejenigen, die diese Prozesse begleiten und natürlich auch die Fragen stellen, von denen anfangs ausgegangen wird.
Diese partizipativen Ansätze scheinen auch in die Auffassung von Christiane Spiel zu passen. Sie ist Professorin für Bildungspsychologie an der Universität Wien: „Kinder und Jugendliche müssen lernen, mit Veränderung umzugehen“, erwähnt sie bei der Podiumsdiskussion im Museumsquartier. Dabei sei es auch wichtig, aufseiten der Lehrer nicht nur eine Lösung für ein Problem zu geben, sondern zu fördern, dass gemeinsam mit einem Team an einer Vielzahl von Lösungen gearbeitet wird. Im nächsten Schritt gehöre auch noch dazu, zuzuhören, welche Logik andere Gruppen für sich beschlossen haben und daraus zu lernen. „Es geht nicht darum, Fehler der Schüler aufzuzeigen, sondern ihnen Mut zu geben, etwas zu verändern.“
Fotocredit: iStock