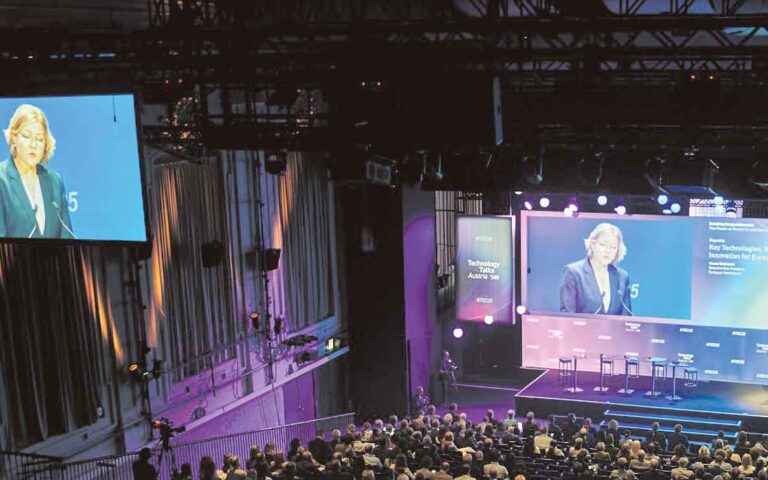Auf den Finanzmärkten geht es tierisch zu: Die Bullen treiben die Börsen nach oben, die Bären scheuchen sie nach unten. Und der schwarze Schwan? Der brachte Corona. Was bringt die finanzwirtschaftliche Zeitrechnung nach Covid-19? Weiterhin niedrige Zinsen, vermehrte Lust aufs Sparen und eine Suche nach alternativen Anlageformen.
Sir Karl Popper führte einst aus, die Wissenschaft könne trügen, es sei nie und nimmer möglich, Hypothesen endgültig zu beweisen. Bei Schwänen beispielsweise würde die Hypothese gemeinhin lauten: Alle Schwäne sind weiß. Poppers Logik: Nur ein einziger schwarzer Schwan auf der ganzen Welt würde die wissenschaftliche Meinung zum Einstürzen bringen. Diesen schwarzen Schwan hat sich nun die Finanzwelt als Metapher geliehen. Er steht für ein kaum vorhersehbares, unwahrscheinliches Ereignis mit weitreichenden Konsequenzen. Und dieser schwarze Schwan erschien in Form eines Virus und brachte so ziemlich alles durcheinander.
In nur drei Monaten gingen durch Einbrüche der Märkte in Europa 771 Mrd. Euro verloren, in Österreich waren es 15 Milliarden. In den ersten Wochen des Lockdowns brach die heimische Wirtschaft um ein Viertel ein. Während die einen über die Katastrophe klagten, freuten sich andere: Jeff Bezos von Amazon beispielsweise, dessen Vermögen durch Corona und den Höhenflug der Aktie seit Jahresbeginn um 24 Mrd. auf 138,5 Mrd. Dollar angestiegen ist. Oder Apple: Das Unternehmen überschritt zu dieser Zeit die 2‑Billionen-Grenze seines Börsenwertes. Und auch die Sparvermögen sind gestiegen, wie die Bank ING herausgefunden hat: Während das Privatvermögen der Österreicherinnen und Österreicher im ersten Quartal 2020 um 2,2 Prozent gesunken ist, stieg es dank Erholung der Kapitalmärkte und hoher Neuanlagen um 3 Prozent.
Sparquote gestiegen
Und wie ging es der heimischen Bankwirtschaft? Der Vorstandsvorsitzende der Steiermärkischen Sparkasse, Gerhard Fabisch, erinnert sich: Es sei Anfang März nicht nur ein Wettlauf mit der Zeit gewesen, die organisatorischen Strukturen einzurichten, damit bei Verkündung des Lockdowns der Bankbetrieb weitergehen konnte. Es galt auch, besorgte Kunden zu beruhigen und den Unternehmen Liquiditätshilfe zu geben. Mit heutigem Stand betreffe der Großteil der Hilfsmaßnahmen das Kreditratenstundungsprogramm für rund 11.000 Kunden, zusätzlich wurde Liquidität in der Höhe von etwa 600 Millionen Euro bereitgestellt. Das Bankgeschäft im April und Mai sei sehr gedämpft gewesen, doch die Sparquote sei – wie oft in schwierigen Situationen – gestiegen, betont Fabisch. Lag die Sparquote im Februar noch bei sechs bis sieben Prozent des verfügbaren Einkommens, ist sie in der Krise auf vierzehn Prozent gestiegen – aktuell liege man bei zehn, elf Prozent. Wobei: Das Gesparte sei „für den Notfall“ auf dem Girokonto belassen oder auf das Sparkonto umgeschichtet worden.
Das Zinsniveau werde noch länger auf tiefem Niveau bleiben, möglicherweise bis zu zehn Jahre, schätzt Fabisch. Auf dem Finanzmarkt gebe es Liquiditätsüberschüsse, Banken müssten teilweise sogar Strafzinsen für die Veranlagung untereinander zahlen. Er sieht die Strukturiertheit der österreichischen Wirtschaft als großen Vorteil: Viele Unternehmen seien Familienbetriebe, die einerseits auf einer besseren wirtschaftlichen Basis stünden und eher private Mittel einsetzen, um eine Krise zu überstehen. „Wir schätzen die Leistungsfähigkeit und Resilienz unserer Kunden als hoch ein.“ Freilich sei es in dieser Krise schwieriger, Schlüsse zu ziehen, nachdem sie keine punktuelle oder Branchenkrise sei, sondern alle Bereiche treffe, erklärt Fabisch.
Welche Anlagetipps hat man bei der Steiermärkischen Sparkasse? „Fonds haben immer den großen Vorteil der Streuung, man kann die Mischung aus Aktien und Anleihen selbst wählen“, sagt Fabisch. Einzeltitel in Anleihen und Aktien können das Portfolio, je nach Risikoappetit, erweitern. Fonds sollten etwa 50 Prozent der Finanzierungsveranlagung ausmachen. Besonders erfahrene Anleger können strukturierte Produkte – etwa Wandelanleihen – ergänzen. Gold als Beimischung in beschränktem Umfang sei ebenfalls attraktiv, allerdings liege der Kurs bei ca. 2.000 Dollar pro Unze aktuell sehr hoch, zu 1.400 Dollar vor der Krise. Auch wenn gern über tolle, gewinnbringende „Superaktien“ geredet werde: Selbst große Stiftungen legten ihr Geld eher konservativ in Fonds mit Anleihen und teilweise Aktien an, betont Fabisch – wobei natürlich aufgrund der Zinssituation Aktien interessanter seien. Aktien sollten nur gewählt werden, wenn das Geld über längere Zeit liegen bzw. arbeiten kann, der Ein- wie auch der Ausstieg muss geplant werden und die Kursentwicklungen beobachtet. Die Veranlagung einer größeren Summe sollte über einen längeren Zeitraum erfolgen. Wichtig sei, sich vorab die Frage zu stellen: Ist man auf das Geld angewiesen, muss man sich stark einschränken, falls Wertverluste eintreten? Entscheidungen für die Anlageklassen sollten durchgehalten werden, alles andere kostet nur Geld.
Alternative Veranlagungen sind gewünscht
Auch mit Leidenschaften lässt sich Geld machen. Der „Knight Frank Luxury Investment Index“ berücksichtigt außergewöhnliche Investments – etwa Antiquitäten, Briefmarken, Wein, Kunst, Oldtimer, Uhren – und verzeichnete seit 2010 auf alle Bereiche ein Plus von 141 Prozent. Der Oldtimermarkt stieg in den letzten zehn Jahren laut Classic-Car-Index auf 194 Prozent, der Whisky-Index kletterte auf stolze 564 Prozent. Es gibt sogar einen Index für Handtaschen, dieser schaffte es in den vergangenen zehn Jahren „nur“ auf ein Plus von 108 Prozent. Doch dann kamen seltene Hermes-Taschen auf den Markt. Laut „Knight Frank Wealth Report“ schafften Handtaschen dadurch im Vorjahr mit einem Plus von 13 Prozent den größten Wertzuwachs im Bereich dieser alternativen Veranlagungsformen. Whisky lag bei nur fünf Prozent, ebenso Kunst. Zweitbester Performer nach den Handtaschen waren 2019 Briefmarken (plus sechs Prozent), Münzen legten um drei Prozent zu, Uhren um zwei und Wein um ein Prozent. Ein wichtiges Kriterium bei diesen Assets ist Seltenheit. So konnte auf dem Oldtimermarkt der BMW 507, von dem nur 254 Stück produziert wurden, auf 800 Prozent Wertsteigerung „beschleunigen“.
Georg Zenker vom Beratungsunternehmen Bogen und Partner bemerkt bei seinen wohlhabenden Kunden verstärkt den Wunsch nach Direktinvestments oder alternativen Veranlagungen. Auch er deckt mit seinem Team Renditebringer in Ergänzung zur börsenbasierten Vermögensverwaltung ab, etwa mit Edelsteinen, Immobilien oder Firmenbeteiligungen (mehr dazu ab Seite 28). Immobilien gelten dabei als All-Time-Favoriten, bei vielen Anlegerwohnungen sind die Vorverkaufsgrade schnell erreicht, zudem haben private Immobilienbesitzer durch Corona ihre Wohnsituation einer genaueren Prüfung unterzogen und sind veränderungsbereit. Was bedeutet, dass aktuell einerseits mehr Objekte auf dem Markt sind, Immobilien aber auch gesucht werden.
Nicht blauäugig ins Immobiliengeschäft gehen
Hier mahnt Rechtsanwalt Michael Kropiunig, Experte unter anderem im Bereich Immobilienkauf und ‑miete, zu Absicherung schon im Vorfeld. Vor dem Kauf einer Wohnung solle die Eigentümergemeinschaft geprüft werden, die Frage nach der Nutzbarkeit der Allgemeinflächen und ob es Rücklagen für Sanierungen oder Reparaturen gibt. Ist das nicht vorhanden, kann die Rendite bei aufwendigeren Reparaturen schnell dahinschmelzen. Zu besonderer Vorsicht rät er bei der Wahl der Mieter: Mietnomaden, deren es nicht wenige gäbe, seien bei gewerblichen Vermietern meist gesperrt und wichen auf den privaten Markt aus, ein Dilemma für den Wohnungsbesitzer. Räumungsklagen würden sich mindestens über ein halbes Jahr ziehen, in der Zeit fließt weder Geld für Miete und Betriebskosten, „und obendrein bekommt der Besitzer möglicherweise eine beschädigte Wohnung zurück“, betont Kropiunig. Als Lösung empfiehlt er, die Kaution im Mietvertrag entsprechend hoch anzusetzen, damit nicht nur Mietrückstände, sondern auch allfällige Schäden abgedeckt sind. Schon beim ersten Ausbleiben der Miete solle man hellhörig werden und spätestens beim Nichtzahlen der zweiten Miete einen Anwalt mit der Räumungsklage beauftragen.
Foto: Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse
Fotocredit: Margit Kundigraber