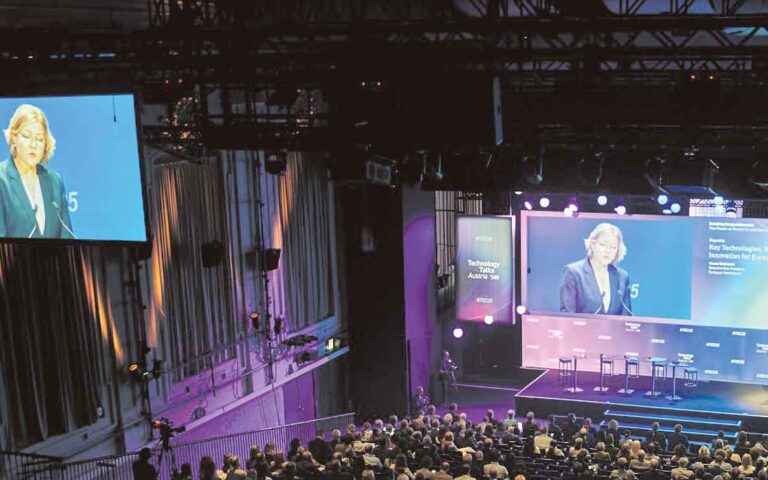Was bringt es, statt mit dem Auto mit der Bahn zu fahren und weniger Fleisch zu essen? Kann ich damit die Welt retten? Eine Suche nach Antworten. Das Argument ist bekannt: „Was bringt es, wenn ich brav Müll trenne, während China Milliarden an Tonnen CO2 ausstößt?“ „Warum sollte ich weniger Fleisch essen, wenn’s doch schmeckt?“ „Was bringt es, wenn gerade ich mein Auto stehen lasse?“ Warum? Weil alles ziemlich knapp wird. Unser Klimadilemma ist hausgemacht, denn nicht China, sondern die westlichen Industrieländer haben jahrzehntelang die Abgase in die Atmosphäre geblasen. Dennoch bleibt die Frage: Was kann ich als Einzelne am Dilemma ändern?
Zuerst gilt es, eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Ich habe dazu den Joanneum-Research-Lifestylecheck gemacht. Darin wird berechnet, wie schädlich mein Autofahren ist – also wie viel CO2 ausgestoßen wird und welche Umweltkosten bei der Fahrzeugproduktion anfallen –, und welche Umweltbelastung mein Konsumieren bedeutet. Es wird das Heim berücksichtigt, in dem ich wohne und das mir trotz thermischer Sanierung ein dickes Minus einbringt, weil es alt ist. Mehr als negativ zeigt sich mein letzter USA-Flug. Doch für mich als Shoppingqueen das größte Dilemma: Ich kaufe zu viel Kleidung. Ach ja, auch Laptop und Smartphone schlagen sich negativ in meiner persönlichen Klimabilanz nieder. Diese ist vernichtend: Mit einem Ausstoß von 9,4 Tonnen CO2 liege ich um 31 Prozent über dem, was ich verbrauchen sollte.
Es braucht einen „Tipping Point“
Wir haben ein Wohlstandsproblem. Soziologen der Universität Graz haben berechnet, dass 500 Euro mehr Einkommen eine zusätzliche Tonne CO2-Äquivalente bedeuten. 2,7 Tonnen pro Jahr sollte laut den strengsten zu findenden Vorgaben das Maximum sein, wollen wir den Planeten erhalten, laut Joanneum Research kommt jede Österreicherin und jeder Österreicher auf bis zu 15 Tonnen. Und, ja, das Argument, ein Einzelner könne nichts erreichen, stimmt, aber nur im Ansatz, wie Markus Hadler von der Uni Graz betont. Die größten Klimawandeltreiber sind die Bereiche Energie, Landwirtschaft, Industrie und Verkehr, sogar der Verzicht auf Rind- oder Lammfleisch bringe mehr als Mülltrennen, sagt er. Was, wenn wir so weitermachen? Es müsse einen „Tipping Point“ geben, der das bisher Gewohnte zum Kippen bringt, quasi: Was zu tun ist, entscheiden wir erst, wenn die Temperaturen wirklich um vier Grad gestiegen sind.
Aus diesem Grund gibt es immer mehr Stimmen, die CO2-Emissionen einen Preis geben wollen, soll der Konsum von Fossilenergie, die Hauptursache der Klimakrise, abnehmen. Statt das Fluggeschäft zu subventionieren, sollte mit der Bahn eine attraktive Alternative geschaffen werden, lautet dazu ein oft gehörtes Argument. Die EU hat mit ihrem Green Deal Großes vor und wenn schon viele der Verursacher in Europa beheimatet sind, könnte die Klimakrise auch politisch hier entschieden werden, findet Reinhard Steurer von der Universität für Bodenkultur (Boku). Für ihn ist Fakt: „Entweder wir zahlen jetzt etwas für CO2-Emissionen oder jeder von uns zahlt in der Zukunft das Vielfache für die Schäden von Klimakatastrophen, etwa in Form von teureren Lebensmitteln wegen Ernteausfällen.“ Nachsatz: Wer gegen einen Preis auf CO2 sei, könne genauso gut dafür eintreten, dass Abwässer ab sofort ohne Kosten ungereinigt in Flüsse eingeleitet würden.
Weil Klimaschutz eine globale Herausforderung ist, bringt es nicht viel, Schuldige zu suchen, betont Angela Köppl vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Vor allem muss vieles von den gängigen Vergleichen gewichtet werden. Wenn man schon China als Umweltverschmutzer bezeichnet, muss man auch das jährliche Emissionsvolumen auf die Bevölkerung herunterbrechen und das ergibt einen Footprint, der nicht höher als der eines Mitteleuropäers ist. Und wahrscheinlich besser als meiner. Klimaschutz sei, so Köppl, eine globale Herausforderung, zudem habe sich Österreich im Rahmen der Pariser Klimaziele vertraglich verpflichtet, die Emissionen zu senken. Auch wenn Österreich mit der Wasserkraft auf einem guten Weg ist, sei die Energiewende dadurch noch nicht geschafft, ergänzt Köppl. Einzig die Industrie zahlt für ihre Treibhausgase mit dem Emissionshandel. Doch wohin das Geld aus dem Zertifikatehandel fließt, ist nicht bekannt.
Ab 2020 müssten Emissionen sinken
Nach wissenschaftlichem Konsens müssten ab heuer die Emissionen sinken, um noch schlimmere Umweltfolgen zu vermeiden. Doch tatsächlich geht es mit den Treibhausgasen seit 2009 kontinuierlich nach oben. Zu viele Autos, zu viel Verkehr. Also braucht es doch eine Renaissance des Sparens, der freiwilligen Enthaltsamkeit? Dazu könnte ein Versuch Schule machen, über den der Soziologe Markus Hadler von der Uni Graz berichtet: Eine Informationskampagne über das Stromsparen in einem Mehrfamilienhaus zeigte dann Wirkung, als die Verbrauchszahlen der jeweiligen Parteien öffentlich gemacht wurden. Es muss also unbequem für den Einzelnen sein. Doch der ist träge, unser Gehirn ist so programmiert, Dinge, die unbequem sind, zu vermeiden. Und so fahren wir mit dem Auto und verhalten uns weiter wie bisher. Jeder glaubt das, was seine Haltung bestärkt, um die eigene Bequemlichkeit nicht opfern zu müssen, werden Fakten zu Autoabgasen geschönt. So gesehen kommt wieder das Preisthema ins Spiel, wonach Klimaschutz andere Preisgestaltungen braucht – das Billig-Shirt, das in Fernost unter schlechten Bedingungen produziert wird, müsste eigentlich mehr kosten als ein nachhaltig hergestelltes. Eine weitere Möglichkeit wäre ein CO2-Bonus, wie er in der Schweiz an jene Bürger ausbezahlt wird, die statt mit dem Auto mit der Bahn fahren.
Es geht nur miteinander
Der zuvor erwähnte Lifestylecheck von Joanneum Research soll jedenfalls weiterentwickelt werden, sagt Franz Prettenthaler vom dortigen Life-Institut für Klima, Energie und Gesellschaft. Informationen über die persönliche Klimabilanz sollen dann direkter verfügbar sein, etwa indem ein Kassabon abgescannt wird und über den Rechner Feedback in Bezug auf die Klimafreundlichkeit des Einkaufs gegeben wird. Der Lifestylecheck werde bereits in Betrieben zu Verhaltensänderungen herangezogen, dort werden innerhalb der Belegschaft Maßnahmen diskutiert und beschlossen – etwa was die Mobilität oder das Angebot in der Kantine betrifft –, die den persönlichen Footprint schmälern. Denn von den 15 Tonnen konsumbasierten Fußabdrucks könne man die Hälfte selbst gut beeinflussen, betont Prettenthaler. „Uns geht es dabei um das Thema Selbstwirksamkeit. Nicht das Individuum soll die ganze Last aufgebürdet bekommen. Doch für die Hälfte dessen, was jeder und jede beeinflussen kann, braucht es wiederum Partnerschaften, damit die Veränderungen möglich sind.“ Klimahandeln sei immer eine Sache von Politik, Wirtschaft und dem Individuum. Die am besten miteinander versuchen, das Klimading auf die Reihe zu bekommen.
Was bedeutet das nun für mich? Ich habe mir vorgenommen, öfter auf Fleisch und tierische Produkte zu verzichten und die Shoppingqueen in mir einzubremsen. Wo es geht, nehme ich den Zug. Das sind laut neuer Berechnung des Footprintrechner nur noch 5,1 Tonnen CO2-Emissionen, damit bin ich 29 Prozent besser als der Durchschnitt. Die 2,7 Tonnen, die es bräuchte, werde ich vermutlich nicht so schnell erreichen.
Illustration: Reinhard Gussmagg