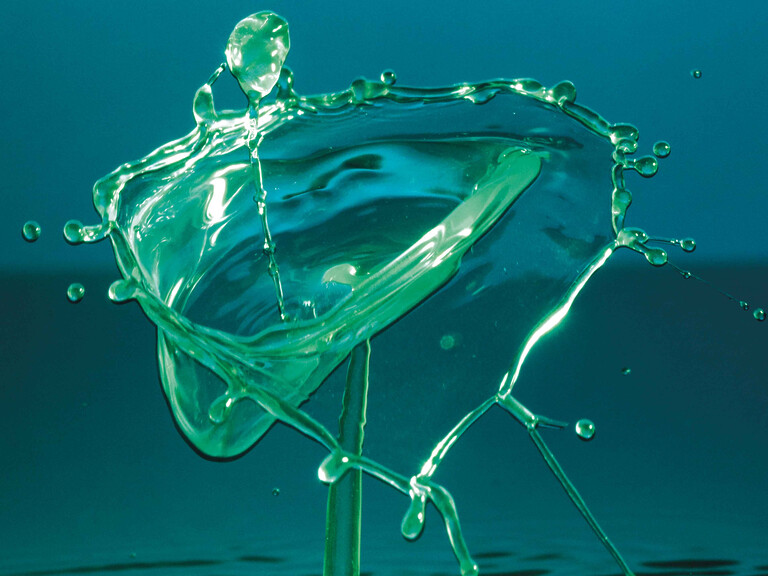Ganze 12 Millionen Klicks zählt das Video, das Sophia, ein menschlich aussehender Roboter, zu Gast in der Show des USamerikanischen Talkshow-Moderators Jimmy Fallon zeigt. Man sieht, wie Sophia beim Schere-Stein-Papier-Spiel gewinnt und darauf spöttisch sagt: „Das ist nur der Beginn meines Plans, das menschliche Geschlecht zu dominieren.“ Viel Gelächter aus dem Publikum, jedoch ein wenig verhaltener als bei anderen Gästen der Show. Sophia hatte einen Nerv getroffen: Wie konnte es sein, dass diese Technologie uns scheinbar ohne unser Wissen überholt und nun bereits solche menschlichen, ja übermenschlichen Züge angenommen hatte?
Sieht man 2017 als das Jahr, in dem künstliche Intelligenz bekannt geworden ist, dann wurde sie 2018 zum Mainstream. Allein 2018 generierte die Berichterstattung über Sophia beinahe zehn Milliarden Klicks. Einige outeten die Maschine als gelungenen PR-Trick, viele waren aber trotzdem beunruhigt über die rezenten Fortschritte der Robotik. Und selbst wenn die Ansätze auf Seiten der Technologie und Wissenschaft bereits sehr divers sind, dreht sich der öffentliche Diskurs meist immer noch um die gleiche Vorstellung: eine dystopische Zukunft mit Robotern, die die Menschheit – überspitzt gesagt – irgendwann überflüssig machen werden. Selbst berühmte Charaktere wie Elon Musk, Wladimir Putin und zu Lebzeiten auch Stephen Hawking scheinen das zu befeuern, indem sie uns vor den Gefahren, die von künstlicher Intelligenz ausgehen, warnen. Auch Medien berichten gerne über eine hoffnungslose Zukunft, in der Roboter unsere Jobs übernehmen, oder – glaubt man Putin – irgendwann sogar die Weltherrschaft an sich reißen werden.
Im unheimlichen Tal
Jedoch warnen sie alle vor dem Falschen: Martina Mara, Professorin für Roboterpsychologie am Institute of Technology der Johannes-Kepler-Universität Linz beschäftigt sich nicht mit Robotern, die auf ihrer Couch liegen und über Problemen sprechen – das würde gar keinen Sinn machen, denn Roboter hätten ja gar keine Psyche, sagt sie beim Kamingespräch des Europäischen Forum Alpbach. Vielmehr dreht sich ihre Arbeit um die Technologieanwender und ihre Befürchtungen. In Alpbach sprach Mara auch vom sogenannten „Uncanny Valley Phänomen“, das Phänomen des unheimlichen Tals, formuliert vom japanischen Robotiker Masahiro Mori. Es beschreibt jenen Punkt, an dem unsere Sympathie gegenüber Maschinen wie Sophia umschlägt. Ein wenig Ähnlichkeit mit uns selbst finden wir sympathisch, zu viel wird uns jedoch schnell unheimlich.
Die meisten vergessen dabei einen wichtigen Fakt: Auch diese scheinbar unheimlichen Eigenschaften – von Aussehen bis Aussagen – stammen ursprünglich aus Menschenhand, wie auch Martina Mara erwähnt. Und was wäre menschlicher, als unsere Emotionen zu spiegeln? Das konnte man auch bei Sophia beobachten. Die logische Folge: Sie antwortete auf die Frage mit der erwarteten Antwort und verstärkte dadurch bereits bestehende Bedenken. Dabei übersteige Sophias Bewusstsein kaum das eines Toasters. Eine Nachahmung menschlicher Intelligenz liege auch gar nicht im Interesse der Entwickler, so Mara: „99 Prozent der Entwickler künstlicher Intelligenz haben gar kein Interesse Menschen zu replizieren, aber fokussieren sich auf andere Dinge wie selbstfahrende Autos.“
Die Art, wie wir künstliche Intelligenz in der Öffentlichkeit darstellen, führt dazu, dass die Leute vor den falschen Dingen Angst haben. Es gehe aber nicht darum, Digitalisierung zu verbieten oder aufzuhalten, sondern Regeln festzulegen, wie wir mit dieser Technologie – die sich unvermeidlich durchsetzen wird – in Zukunft umgehen werden. Auch Professor Jim Al-Khalili, britischer Physiker und bald Präsident der British Science Association, warnte in einem Vortrag vor der unzureichenden Transparenz in unserem Umgang mit den neuen Technologien. Ohne diese könnte das volle Potenzial jedoch nie ausgenützt werden. Stattdessen blieben die Möglichkeiten und die damit einhergehende Macht in den Händen einiger weniger Monopolfirmen.
Positive Ansätze für die Zukunft
Die Ansätze für eine positive, von Technologie und künstlicher Intelligenz geprägte Zukunft sind divers. Einerseits gehe es um die Steigerung des öffentlichen Bewusstseins, so Al-Khalili. Davon gibt es bereits viel: Man denke an das jährliche Linzer Ars Electronica Festival, das erst wieder Mitte September über die Bühne ging und mit 105.000 Schaulustigen den Besucherrekord brach. Auch der im November stattfindende Digital Future Kongress in Graz setzt auf diverse Themen rund um die Problematik wie zum Beispiel bei einem Vortrag über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der medizinischen Bildgebung.
Dazu kommen Ansätze mit vielversprechenden Auswirkungen, die auf den ersten Blick nicht einmal unbedingt an künstliche Intelligenz erinnern. So wurde an der medizinischen Fakultät der New York University erst kürzlich ein Vorstoß in die Sphären der künstlichen Intelligenz bekannt – und das auf erstaunliche Weise. August dieses Jahres wurde bekannt, dass sie gemeinsam mit Facebook ein Projekt gestartet hatten, bei dem künstliche Intelligenz für MR-Scans eingesetzt werden soll. So würden diese zehnmal schneller absolviert werden. Besonders für junge oder klaustrophobische Menschen kann die Dauer eines solchen Scans eine Herausforderung darstellen. Dazu kommen lange Wartezeiten für Termine, besonders in ländlichen Gebieten, in denen oft nur ein Gerät zur Verfügung steht. Herkömmliche Maschinen hatten numerische Rohdaten zu Bildern verarbeitet. Das bedeutetet: je mehr Daten, desto länger der Scan. Mit der künstlichen Intelligenz könnten weniger Daten zu den gleichen Ergebnissen führen, da auf ein Daten-Set von 10.000 klinischen Studien zurückgegriffen wird und die Bilder so schneller konstruiert werden können.
Medizin ist nicht der einzige Bereich, in dem eine positive und differenziertere Darstellung künstlicher Intelligenz ein vielversprechenderes und realistischeres Bild der Zukunft zeichnen kann. Das kann auch in Form von Bildung geschehen und der Integration des Themas in den Unterricht. Auch Bildungsminister Heinz Faßmann sprach neulich davon, in den Lehrplänen Platz für digital relevante Dinge zu machen. Es folgte das Fach digitale Grundbildung. So können überzogene Erwartungen und Befürchtungen demystifiziert und den Leuten Werkzeuge gegeben werden, den vermeintlichen Kontrollverlust zu bekämpfen.
Weniger Bedenken durch Realismus
Mark Coeckelbergh, Philosoph an der Universität Wien, sprach in Alpbach auch davon, dass der Diskurs rund um eine Machtübernahme durch Roboter oder ein vermeintliches Ende der Menschheit von zukünftigen, realen Abläufen ablenkt. So zum Beispiel auch die Sorge um den Verlust vieler Arbeitsplätze. Gerade wenn es um die Auswirkungen der Automatisierung auf den Arbeitsmarkt geht, verlässt viele der Optimismus. Die Prognosen gehen oft weit auseinander, manche sprechen von einem weltweiten Verlust von 1 Million Jobs, andere von bis zu 890 Millionen Jobs bis zum Jahr 2030. Aus einem neuen Bericht des World Economic Forums geht hervor, dass 2025 Roboter 52 Prozent der momentanen Arbeitsaufgaben übernehmen werden. Das ist beinah das Doppelte von dem, was sie heute beanspruchen – zur Zeit liegt es bei 29 Prozent.
Jedoch gibt es auch Bereiche, in denen künstliche Intelligenz Mängel ausgleichen könnte. Auch im Bereich Pflege. Doch auch dort wird nicht ein Pflegeroboter mit menschlichen Antlitz den Krankenpfleger ersetzen, so Martina Mara. Vielmehr geht es um Bereiche wie Heben, Transport oder Datenanalyse – und sowohl die als auch der soziale Aspekt des Berufs, funktioniere nicht ohne eine menschliche Supervision.
Die Forscher des World Economic Forum sprechen auch von neuen Rollen, die durch eine richtungsweisende Veränderung der Aufgaben entstehen könnten. Dazu gehören auch wirtschaftliche Bereiche, in denen menschliche Kompetenz gefragt ist, wie Marketing, Kundenservice oder auch Jobs rund um Social Media. Eine allgemeine Übernahme der menschlichen Fähigkeiten wird es also nicht geben, wie auch die beiden USForscher Erik Brynjolfsson (MIT) und Tom Mitchell (Carnegie Mellon University) im Fachblatt Science schreiben. Zwar würden wir erst am Beginn einer großen Transformation stehen, jedoch dürfe man zwei Dinge nicht vergessen: Maschinen sind nicht in der Lage die gesamte Palette unsere Fähigkeiten zu übernehmen. So zählten die Wissenschaftler Aufgaben, die jeder Job zu erledigen hatte. Ein Radiologe hat beispielsweise 26 verschiedene Tätigkeiten. Einige davon wie das Auswerten von bildgebenden Materialien könnten leicht von Robotern übernommen werden, vielleicht sogar besser als vom Radiologen selbst. Bei anderen Fähigkeiten wie das Mitteilen von medizinischer Information an die Patienten dürfte das schwieriger werden. Außerdem haben wir Menschen ein implizites Wissen, durch das wir beispielsweise Gesichter erkennen oder Fahrrad fahren können. Auch werden Jobs auf jeder Einkommensstufe ungefähr gleich stark betroffen sein. Sorgen um eine Spaltung der Gesellschaft durch den maschinellen Ersatz industrieller Jobs (etwas, das an die industrielle Revolution erinnert), könnten dadurch gelindert werden. Brynjolfsson und Mitchell sprechen deshalb davon, dass Maschinen Arbeit und die damit zusammenhängenden Aufgaben in der Zukunft neu designen, sie aber nicht ersetzen werden. In diesem Sinne: Fürchtet euch nicht!
Fotocredit: ITU Pictures, Wikimedia Commons