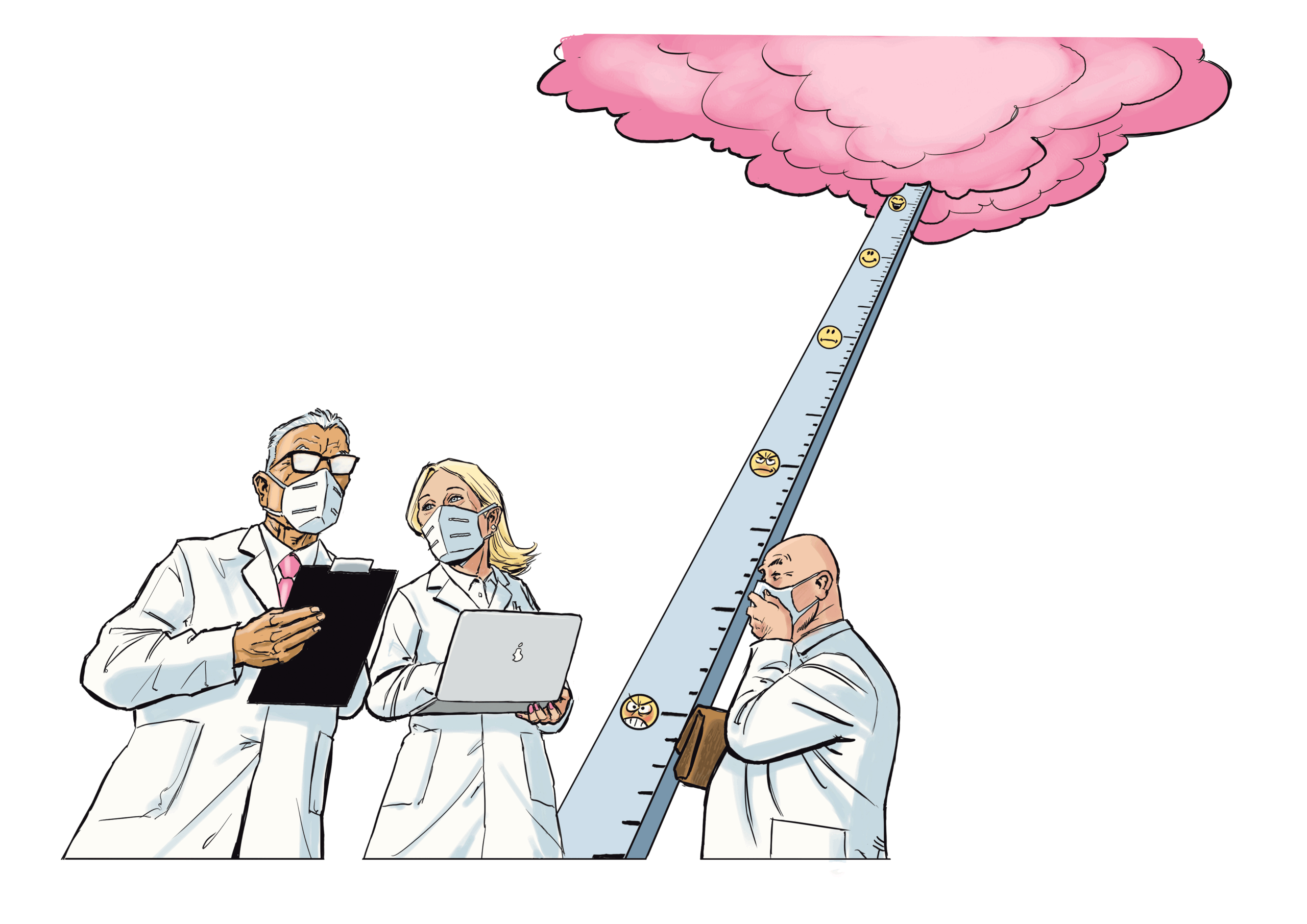Jeder ist es gerne. Alle streben es an: glücklich sein. Aber wie bekommt man das mit dem Glück bloß bestmöglich hin? Man könnte die Finnen fragen. Oder Glücksforscher, die sich an der Messbarkeit des Wohlbefindens abarbeiten. Oder stimmt es und Glück ist tatsächlich nur ein scheues Vogerl? Eine Spurensuche.
Herr Rossi sucht das Glück. Herr Ruckriegel aber auch. Herr Höfer detto. Und Herr Deaton sowieso. Im Grunde genommen tun wir es ja alle. Aber ist auch genug für alle da? Wo findet man es? Was muss man dafür tun, um es zu bekommen? Lässt es sich erzwingen? Erkaufen? Eintauschen?
Lohnen würde es sich. Denn Glück fühlt sich nicht nur gut an, es macht – das zeigen viele Studien – Menschen kreativer, leistungsfähiger, ja sogar gesünder. Nicht zuletzt deshalb ist das Thema auch zunehmend für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft interessant geworden. Denn nicht Wohlstand und Wirtschaftswachstum allein schaffen die Voraussetzungen für ein gelingendes, glückliches Leben. Da ist noch etwas, das unser Leben reicher macht: Glück.
Aber was ist das eigentlich – Glück? Ein Gefühl? Eine Spielart des Schicksals? Mentale Einstellungssache oder messbares Hormonspiegelresultat? Oder ein Mix aus allem? Was Glück jedenfalls ist: ein Forschungsgegenstand. Im interdisziplinären Fachgebiet Glücksforschung setzen sich vor allem Psychologen, Soziologen, Ökonomen, Neurobiologen und Mediziner mit dem subjektivem Wohlbefinden auseinander. Es sind Wissenschaftler wie Karlheinz Ruckriegel. Der Professor für Makroökonomie, insbesondere Geld- und Währungspolitik, Psychologische Ökonomie und interdisziplinäre Glücksforschung an der Technischen Hochschule in Nürnberg hat sich ganz dem Thema verschrieben. Genauso wie Stefan Höfer, Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe an der Medizinischen Universität Innsbruck.
Revolutionär ist deren akademisches Faible für das Fachgebiet nicht. Die Auseinandersetzung mit dem Streben nach Glück ist wohl so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst. Seit der Antike ist es wiederkehrendes Thema in der Philosophie. Ab den 1980er-Jahren nimmt die interdisziplinäre Glücksforschung verstärkt Fahrt auf. So thematisieren die Konzepte der Positiven Psychologie, von Martin Seligmann in den 1990er- Jahren wiederbelebt, Aspekte eines gelingenden Lebens.
Wie Gesundheit mehr als die Abwesenheit von Krankheit, „ja neuerdings von einem positiven PCR-Test ist“, konstatiert Höfer, ist auch Glück mehr als die Abwesenheit von Unglück. Allein stand das Modell des rein rationalen, egoistischen Homo oeconomicus in der Volkswirtschaftslehre diesem Denken lange gegenüber. „Man ging davon aus, dass Materielles glücklich machen muss“, so Ruckriegel, der sich vor 15 Jahren der interdisziplinären Glücksforschung verschrieben hat. Es war die Zeit der plumpen, aber eindringlichen Bausparer-Parole „Geld macht glücklich …“ Jeder werbungsgeschädigte TV-Benutzer der 1980er-Jahre kann die untiefe Lebensweisheit bis heute ansatzlos mit „… wenn man rechtzeitig drauf schaut, dass man’s hat, wenn man’s braucht“ fertigjodeln. So etwas prägt. Egal, ob es stimmt.
Weil das tut es natürlich nicht. Oder nur bis zu einem gewissen Grad. Verdoppelt man beispielsweise sein Jahreseinkommen von 15.000 auf 30.000 Euro explodiert das individuelle Glücksgefühl. Verdoppelt sich das Salär auf 60.000 Euro, steigt auch der „Mir geht es gut“-Pegel. Aber dieser drogenhafte Glücksrausch lässt sich nicht ins Unendliche aufblasen. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann stößt das Glückgefühl an eine gläserne Decke und wächst nicht mehr – egal, ob der Kontostand in noch lichtere Höhen entschwindet.
„Wir wissen aus der Glücksforschung, dass – vorausgesetzt die materiellen Grundbedürfnisse sind abgedeckt und eine soziale Teilhabe ist möglich – mehr Geld, Einkommen und Wohlstand das subjektive Wohlbefinden kaum mehr erhöhen“, sagt Ruckriegel. Im Gegenteil: Stetig steigende Ansprüche und der Vergleich mit anderen wirkt dem Glücksgefühl eher entgegen.
Daniel Kahneman und Angus Deaton von der Princeton University haben für diese „Spaßbremsen“-Modellrechnung über den Zusammenhang von Konsum, Armut und Wohlfahrt 2015 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften zugesprochen bekommen. Man darf sich die beiden in diesem Moment als glückliche Menschen vorstellen.
Aber wie kann das mit dem Glück abseits der großen Bühne des Erfolgs und der Anerkennung, nämlich an den kleinen Schauplätzen des Alltags gelingen? So banal ist das nicht – schon allein deshalb, weil jeder in seinem Dasein seinen eigenen Definitionsrahmen von Glück aufgespannt hat. Für die einen bedeutet Glück ein frisches Stück Schokotorte, für andere behübscht ein glitzernder Theaterbesuch oder ein spannendes Buch die Alltagsroutine mit Glück. Dritte macht Kinderlachen glücklich, vierte ein weißer Sandstrand. Für Hungernde ist Glück ein Stück Brot, für Diäteinhalter sind es purzelnde Kilos.
Das führt geradewegs ins Messbare. Ins Vergleichende. In Hitparaden. Wie man Glück in Zufriedenheitsgraden ausdrückt, zeigt beispielsweise der Better Life Index der OECD. Um die Lebensqualität zwischen einzelnen Ländern zu vergleichen, wurde er 2011 als Indikator zur Messung des gesellschaftlichen Wohlergehens ins Leben gerufen. Österreichs Werte liegen in den Themenbereichen Einkommen und Vermögen, Gesundheit, Wohnen, Beschäftigung, subjektives Wohlbefinden, Sicherheit, soziale Beziehungen, Umwelt und Bildung über dem Durchschnitt. Unterdurchschnittlich schneidet Österreich in den Bereichen Work-Life-Balance und Zivilengagement ab.
Alljährlich zum Weltglückstag am 20. März wird der World Happiness Report der Vereinten Nationen veröffentlicht. Der Bericht enthält Ranglisten zur Lebenszufriedenheit. Bewohner in über 150 Ländern werden dafür seit 2012 regelmäßig zu ihrem subjektiven Glücksgefühl befragt. 2021 landete Finnland zum vierten Mal in Folge auf dem ersten Platz. Die Finnen! Besser lässt sich nicht beweisen, dass Glück auch auf viel Schweigen und wenig Lachen wuchern kann. Bei der Bewertung werden nämlich Parameter wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, soziale Unterstützungen, die Erwartung an gesunden Lebensjahren oder die Möglichkeit zu freien Entscheidungen berücksichtigt. Entsprechend finden sich am anderen Ende Länder wie Afghanistan, Südsudan, Zimbabwe, Ruanda und die Zentralafrikanische Republik.
„Staaten wie Neuseeland richten ihr Staatsbudget bereits an diesen Indikatoren aus“, sagt Ruckriegel. Dass die Musterschüler in Europa wieder einmal aus Skandinavien kommen, liegt daran, „dass sich diese Länder durch ein höheres Maß an Vertrauen in die Gesellschaft, ein geringeres Maß an Ungleichheit und eine Dichte an staatlichen Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung auszeichnen“. „Man sollte jedoch nicht außer Acht lassen, dass es natürlich auch dort unglückliche und unzufriedene Menschen gibt. „Glücklich und unglücklich sein können durchaus zwei separate Kontinua darstellen“, so Höfer.
Glück kann demnach …
… vieles sein. Auch das genaue Gegenteil. Glück kann der Zufall sein, der einen überrascht. Aber auch das Ergebnis von gezielter Empathie. Glück kann ein flüchtiger Gedanke ein. Aber auch ein bewusstes Verhalten. Insofern lässt sich Glück auch erlernen. Weil es auf einer Grundeinstellung basiert, deren Säulen man selbst gestalten kann. Wie? Indem man Dankbarkeit in sein Leben bringt – sie trainiert den Glücksgefühlsmuskel der Seele.
Gut, das klingt möglicherweise esoterisch, abstrakt, unscharf. Aber auch die deutsche Sprache, sonst bekannt für ihre Präzision, leistet sich zum Thema Glück eine gewisse Ungenauigkeit. Denn das Wort Glück meint – anders als etwa in der englischen Unterscheidung von „luck“ und „happiness – sowohl das Zufallsglück in Form eines Lottogewinns als auch den Zustand subjektiven Wohlbefindens.
Aber was macht uns denn überhaupt glücklich? Soziale Beziehungen, psychische und physische Gesundheit und eine erfüllende, sinnstiftende Tätigkeit sind laut Ruckriegel wesentliche Erfolgsfaktoren dafür. Zudem wollen wir unsere Grundbedürfnisse nach Autonomie, Selbstwirksamkeit und Zugehörigkeit befriedigen.
Denn Glücklichsein hat zwei Ausprägungen: das emotionale und das kognitive Wohlbefinden. Mit emotionalem Wohlbefinden ist die momentane Gefühlslage gemeint. Eine wesentliche Rolle spielt dabei laut Ruckriegel die tägliche Glücksbilanz. „Das Verhältnis positiver zu negativer Gefühle sollte mindestes 4:1 betragen.“
Kognitives Wohlbefinden meint wiederum die Bewertung, den Grad der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Gesteckte Ziele dürfen durchaus ambitioniert sein. Sind sie aber unrealistisch, sorgt das für Frustration. Ist die emotionale und kognitive Bilanz ausgeglichen, muss das Immunsystem nicht ständig auf Höchstleistung laufen, „das schraubt die Lebenserwartung gut fünf bis zehn Jahre nach oben“.
Bei allen Hebeln, an denen am persönlichen Glücksrad angesetzt werden kann, ist ein Faktor aber nicht beliebig vervielfältigbar: die Zeit. „Um Glück bewusst wahrzunehmen muss man die Achtsamkeit dafür schärfen und stärken, das steigert die Zufriedenheit langfristig“, betont Höfer. Das erste Eis im Frühling, der erste Schnee im Winter hat einen anderen Effekt wie als x‑te Wiederholung. „Ein bloßes Aneinanderreihen von Glücksmomenten macht nicht glücklich“, gibt Höfer zu bedenken.
Das unterscheidet Glück von Geld: Es lässt sich nämlich nicht summieren, aufsparen und irgendwann ausgeben. Glück hat keine Mindesthaltbarkeit. Es will genossen werden. Sofort. Unverdünnt.
Illustration: Erich Tiefenbach